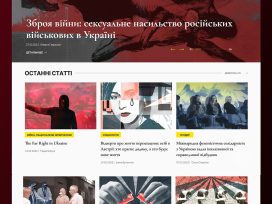Von sexueller Gewalt war und ist im öffentlichen Diskurs stets die Rede. Sie ist kein Tabuthema, wie häufig unterstellt wird. Wer über sie spricht und was dabei zur Sprache kommt oder eben verschwiegen wird, gilt es jedoch genau aufzuschlüsseln, um zu verstehen, wie sich dieses öffentliche Reden und seine Auslassungen zu dem verhält, was wem durch wen tatsächlich geschieht, wenn sexuelle Gewalt ausgeübt wird. Welche Vorstellungen von Tätern und Opfern bestimmen dieses Reden? Und welche Implikationen unterliegen diesen Diskursen? Nicht zuletzt die Debatten und die Art der Berichterstattung um die Ereignisse in Köln in der Silvesternacht 2015/16 verweisen darauf, wie dringlich eine solche genaue Betrachtung der Vorgänge ist. Zunächst mag ein Rückblick auf die Ausgangspunkte der feministischen Debatte um sexuelle Gewalt seit den frühen 1970er Jahren dazu beitragen, genauer bestimmen zu können, was wann in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt und zum Gegenstand wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses wurde.

Women’s flash mob against male violence against women, Cologne, Germany, 9 January 2016. [Sign reads “NO to violence against women”]. Photo: Elke Wetzig. Source: Wikimedia
Dezidiertes Anliegen der Neuen Frauenbewegung war die Forderung nach sexueller Selbstbestimmung. Dem Anspruch männlicher Verfügungsmacht über weibliche Sexualität wurde ebenso der Kampf angesagt wie der geschlechtsspezifischen Zuschreibung von männlicher Verletzungsmacht und weiblicher Verletzungsoffenheit. Häusliche Praktiken sexueller Gewalt und sexuellen Missbrauchs, geschützt verübt in der Intimsphäre des vermeintlich Privaten, wurden öffentlich thematisiert und skandalisiert. Die Parole “Das Private ist politisch” kündigte zugleich die Zuschreibung von Öffentlichkeit (politische Arenen) als männlicher und Privatheit (Familie, Haushalt) als genuin weiblicher Sphäre auf: Frauen begannen, weibliche Lebenszusammenhänge – so der damals gebrauchte Begriff – öffentlich zu diskutieren und kritisch zu hinterfragen. Häusliche sexuelle Gewalt, in der Ehe nebenbei bemerkt zu der Zeit nicht sanktionsfähig, wurde zu einem der zentralen Themen der Auseinandersetzung.
In einem solchen Kontext erschien vor etwas mehr als vierzig Jahren – zu den Hochzeiten der Neuen Frauenbewegung, der Bürgerrechtsbewegung gegen die US-amerikanische ‘Rassen’politik und deren Kriegsführung in Vietnam – Susan Brownmillers Studie “Against Our Will. Men, Women and Rape”. Sie beschreibt darin das Phänomen sexueller Gewalt als historisch durchgängiges, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten und an unterschiedlichen Schauplätzen gegen Frauen, Männer und Kinder von überwiegend Männern verübtes Gewalthandeln, die, wie Brownmiller sagt, vergewaltigen, weil sie vergewaltigen können. Die Praxis sexueller Gewalt wird von ihr als Mittel der Ermächtigung von Herrschaft über Frauen generell und als Akt von Individuen gegen Individuen untersucht: Darüber hinaus sei sexuelle Gewalt auch als Waffe gegen den politischen Feind einsetzbar sowie ein Mittel sozialer, ethnischer und kultureller Unterwerfung, und fungiere als Aneignung von und Verfügung über reproduktive Ressourcen. Die Quellen, derer sich die Autorin bediente, sind im Wesentlichen solche, auf die historische Forschungen zum Thema auch heute noch zurückgreifen.
Susan Brownmillers fundamentale Befunde wurden in den USA und seit den 1990er Jahren – ausgelöst vor allem durch die kriegerischen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda – auch in Europa, Lateinamerika, Asien, Indien und Afrika zum Anstoß gesellschaftlicher Bewegungen gegen und Forschungsarbeiten unterschiedlicher Disziplinen zum Thema sexuelle Gewalt. Brownmillers Thesen stießen gleichwohl auf vehemente Kritik, der zufolge die Autorin vor allem unzulässig und tendenziös generalisiere, zu wenig differenziere und stattdessen monokausale Erklärungsansätze liefere. Ihr wurde eine fundamentalistische Haltung unterstellt und man rückte sie ungerechtfertigterweise in die Nähe derer, die den Praxen sexueller Gewaltausübung als einem, triebtheoretisch gesprochen, biologisch bedingten Zustand begegnen, einem bei der Entfaltung des heteronormativ männlichen Geschlechtscharakters unvermeidlichen Kollateralschaden, den es bestmöglich einzuhegen gilt.
Hergang und Entwicklung dieser theoretischen Auseinandersetzung sind nicht ungewöhnlich: Auf eine fundamentale These, häufig durchaus in provokativer Absicht formuliert, folgt die Forderung nach Ausdifferenzierung, Konkretisierung, nach der Mikro- statt der Makroperspektive – eine Forderung, der die zahlreichen Arbeiten der letzten vierzig Jahre zum Phänomen der sexuellen Gewalt nachzukommen versuchen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Ausgangsthese von der historische Epochen und geografische und kulturelle Räume übergreifenden Allgegenwärtigkeit sexueller Gewaltausübung bis heute nicht ernsthaft widersprochen werden kann.
Diese Allgegenwärtigkeit unterliegt in ihrer konkreten Ausprägung gleichwohl den historischen, ökonomischen und kulturellen Wandlungsprozessen der Gesellschaften, in denen sich sexuelles Gewalthandeln ereignet. Der Vergleich von Praxen dieser Gewaltförmigkeit an unterschiedlichen Schauplätzen kriegerischer Konflikte zeigt, wie sehr sie jeweils von den Dynamiken von Raum und Zeit geprägt sind.
Praktiken, Zuschreibungen und Effekte sexueller Gewalt in einem spezifischen historischen Kontext zu verstehen, ohne deren Regelhaftigkeit aus den Augen zu verlieren, stellt eine methodische Herausforderung dar. Das Anliegen, die Allgegenwärtigkeit sexueller Gewalt sichtbar zu machen, ohne generalisierende Schlussfolgerungen aus ihr zu ziehen, widersetzt sich der Praxis, ihr einen Status der Ausnahme, des Exzesses, der Abweichung von der Regel zuzuschreiben, sie zu marginalisieren und ihre komplexen Bedeutungen und Dynamiken zu negieren. Normative Vorgaben, wie sie in der Rechtsprechung zum Ausdruck kommen, institutionelle Praktiken der Herausbildung von Geschlechteridentitäten, wie etwa die militärische Ausbildung, die gesellschaftliche Positionierung der Geschlechter, sexuelle und allgemeine Körperpraktiken, die Ausprägung von Affektentäußerungen und Emotionshaushalten, Herrschaftsverhältnisse, bevölkerungspolitische Implikationen, subjektive Lebensentwürfe und ökonomische Lebensbedingungen sind einige der wesentlichen Momente, die es zu untersuchen gilt. Damit kann genauer erfasst werden, was eigentlich geschieht, wenn sexuelle Gewalt ausgeübt wird, was den Beteiligten dabei widerfährt, welche Handlungsspielräume gewährt oder erobert werden, welche individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen diese Form von Gewaltausübung zeitigen. Sich solcherart der Komplexität des Themas zu stellen, trägt dazu bei, die Annahme, ein ahistorischer Naturzustand von Sexualität und Gewalt sei am Werk, als Mythos kenntlich zu machen und stattdessen die Bedingungsgefüge und Interessenlagen, die dem gewaltsamen Handeln zugrunde liegen, als veränderbare zu erkennen.
Die dichte Beschreibung dessen, was wann, wo, wie genau sich als sexuelle Gewalt ausagiert, bedarf nicht nur des interdisziplinären und komparativen Zugriffs auf das zu untersuchende Feld, sondern auch der kritischen Selbstreflexion der/des Forschenden, die/der selbst auf je spezifische Weise zu diesem Feld positioniert ist. Aufzuspüren, was jeweils in den Blickpunkt der Fragestellung gerät und was nicht, wie Quellen als solche erkannt und gelesen werden, welches erkenntnisleitende Interesse den Fragestellungen zugrunde liegt, sind unverzichtbare Hilfestellungen bei der Arbeit der Einordnung und Interpretation des Untersuchungsgegenstandes.
1. Kulturelle Vorannahmen
Die Wahrnehmung und Benennung einerseits und die Nichtwahrnehmung und das Beschweigen der Praktiken sexueller Gewalt andererseits sind umgeben von einem Dickicht unhinterfragter Vorannahmen, Mythen und Einschreibungen in kulturelle Gedächtnisse und Tabuisierungen, die es zu entschlüsseln gilt. Die öffentliche Thematisierung von meist nicht öffentlich oder in Grauzonen ausgeübter sexueller Gewalt ist wesentliche Voraussetzung dafür, ein gesellschaftliches Einverständnis darüber herzustellen, dass es sich um Unrechtsverhalten handelt, das es zu sanktionieren gilt. Sie gewährleistet jedoch noch nicht, dass sich eine Gesellschaft tatsächlich damit auseinandersetzt, was denen angetan wird, die dieser Form von Gewalt ausgeliefert sind und die bis heute nur unzureichend selbst zu Wort kommen. So ist es in Kriegen eine zu beobachtende Praxis, dass (tatsächliche oder unterstellte) Exzesse des Gegners instrumentalisiert werden, um ihn zu desavouieren und die Bereitschaft, Krieg zu führen, anzuheizen. Legendäres Beispiel dafür sind die “Rape of Belgium”-Erzählungen im Ersten Weltkrieg. Die Rede von der verletzten Ehre der Nation statt der körperlichen Integrität von – überwiegend weiblichen – Individuen ist ein weiteres, weit verbreitetes Beispiel für eine Verlagerung des Gewaltaktes auf eine politisch instrumentelle Ebene unter Auslassung der Wahrnehmung und Benennung dessen, was den individuellen Opfern tatsächlich geschieht.
Eine normative Übereinkunft, bei der Ausübung sexueller Gewalt handle es sich um ein zu ächtendes Verhalten, ist bis heute nicht umstandslos herzustellen. Bereits der Titel der eingangs erwähnten Studie “Against Our Will” (“Gegen unseren Willen”) widersetzt sich offensichtlich einer Unterstellung, der zur Debatte stehende Gewaltakt könne auch mit Zustimmung derjenigen/desjenigen erfolgen, der/dem er widerfährt. Der häufig in Subtexten etwa in der Belletristik, in Alltagserzählungen, biografischen Schilderungen oder besonders signifikant in Witzen zum Ausdruck gebrachte Umgang mit sexuellen Gewalthandlungen ist geprägt von Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten, in denen Imaginationen von sexuell konnotierter Gewaltlust zum Ausdruck kommen, die Opfer und Täter vermeintlich gleichermaßen genießen würden. Der sexuelle Gewaltakt zwischen zwei vergeschlechtlichten, einander hierarchisch zugeordneten Individuen, im Zuge dessen dem/der einen jeglicher Handlungsspielraum verweigert wird, ist in diesen Imaginationen ausgeblendet und überlagert. Sexuelle Gewalt als Angriff auf die körperliche und sexuelle Integrität fungiert als ein das Opfer beschämendes Unterwerfungsritual, das ob einer drohenden sozialen Ächtung zum Schweigen verdammt wird.
Während sich zahlreiche theoretische Reflexionen dem Zusammenhang von Sexualität, Herrschaft und Geschlecht widmen und Aufschluss darüber geben, in welcher Weise kulturelle Verortungen, normative Vorgaben und Regulierungsinstrumente von Sexualität soziale und politische Interessen in einer jeweiligen sozialen und gesellschaftlichen Formation absichern und repräsentieren, liegen wenige Arbeiten vor, die sich auf ähnliche Weise dem Zusammenspiel von Sexualität und Gewalt/Gewaltausübung widmen. Sexuelle Gewalt in kriegerischen Konflikten erschöpft sich oft nicht in der Ausübung erzwungener sexueller Akte, sondern ist begleitet von massiven körperlichen Verletzungen bis hin zur Tötung des Opfers und des Missbrauchs bereits getöteter Körper.
2. Gesellschaftszustand Krieg
Die Debatte und die Skandalisierung der sogenannten häuslichen Gewalt sind im Verlauf der Auseinandersetzungen mit sexueller Gewalt in den letzten zwei Jahrzehnten merklich in den Hintergrund getreten, wohingegen die Ausübung sexueller Gewalt in kriegerischen Konflikten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erreichen konnte. Die Argumentationsfigur, bei Kriegen handle es sich um eine Form eingehegter, regulierter Gewaltanwendung zur Austragung von Konflikten, um eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, mag angesichts der Erfahrungen im 20. Jahrhundert erheblich an Legitimationskraft verloren haben. Die Imagination vom eingegrenzten und überschaubaren Schlachtfeld, auf dem sich der Krieger bewähren oder den Heldentod sterben kann, ist heute weniger denn je haltbar. Auch in den sogenannten Neuen Kriegen, in denen oft Söldnerarmeen kämpfen und in denen sich im Angesicht der von globalen Wirtschaftsinteressen geprägten Schattenökonomien zahllose bewaffnete Rebellengruppen bilden, liegt die Grenze zwischen Krieg und Frieden in einer oft dauerhaften Grauzone. Die Konstruktion des Ausnahmezustands Krieg, der an einer Front weit weg von der Heimat geführt und an der vom Krieg nur sekundär betroffenen Heimatfront unterstützt wird, deckt sich spätestens seit dem Ersten Weltkrieg nicht mit den Erfahrungen, die gemacht werden, wenn eine ganze Gesellschaft in einen Kriegszustand involviert ist – Erfahrungen, die eine Gesellschaft nachhaltig prägen und die verdeckt oder offen in Familienerzählungen und in das kulturelle Gedächtnis Eingang finden.
Dennoch hält sich hartnäckig die Vorstellung, der Krieg in seinen vielfältigen Ausprägungen sei ein Ausnahmezustand, ein Naturereignis ohne Vor- und mit einer vergehenden Nachgeschichte, wenngleich die Debatten über Krieg, transitional justice, Kriegsopfer und Traumatisierung stark zugenommen haben und auf die Gegenwärtigkeit des Vergangenen verweisen. Sich dem Phänomen sexueller Gewalt zu stellen, es aber gleichzeitig diesem Ausnahmezustand zuordnen zu können, mag leichter fallen, als eine Genealogie sexuellen Gewalthandelns in Nichtkriegs- und Kriegszeiten in den Blick zu nehmen. Die Praktiken sexueller Gewalt im Zivilleben stärker in die Analyse einzubeziehen, kann hingegen veranschaulichen, wie bedrohlich nahe diese dem eigenen Erleben sind und wie und auf welche Weise diese Praktiken das Verhalten im Krieg und den gesellschaftlichen und subjektiven Umgang nach einem Krieg bestimmen. Die Argumentationsfigur des “Kavaliersdelikts” korrespondiert hierbei unübersehbar mit der des “Kollateralschadens”.
Es ist anzunehmen, dass kein Soldat oder – noch immer weit seltener im Kriegseinsatz – keine Soldatin im Voraus wirklich ermessen und wissen kann, wie sie/er die Kriegssituation erleben wird und was sie/ihn konkret erwartet. Aber Soldaten und Soldatinnen haben Vorannahmen und Erwartungen, generiert von der Gesellschaft und dem sozialen Umfeld, in dem sie sich bewegen. Dass der Reiz grenzüberschreitender, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, Erfahrungen dazu gehört, ist ein beliebtes literarisches Sujet und auch in Feldpostbriefen oder Kriegstagebüchern, vor allem der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, nachzulesen.
3. Militärisches Kalkül
Krieg ist eine Extremsituation, was besonders in der für die Führung eines Krieges unabdingbaren Voraussetzung zum Ausdruck kommt, bereit sein zu müssen zu töten und sich der Gefahr auszusetzen, getötet zu werden. Um die damit verbundenen Friktionen der Gefahr aushalten, aber auch das erforderliche Aggressionspotenzial aufbringen zu können, bedarf es des mentalen und körperlichen Trainings, das vor Eintritt in das Konfliktgeschehen zu absolvieren ist.
Die militärische Ausbildung ist geprägt von Widersprüchen. Ein Soldat muss dominant und aggressiv sein, sich aber gleichermaßen gehorsam in der militärischen Hierarchie einordnen und sich ihr unterwerfen; er muss als Individuum Entscheidungen treffen, aber mit seiner kleinen Einheit verschmelzen; er muss Gewalt ausüben, sie aber auch passiv aushalten; er erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung sowohl als Hüter der Zivilisation als auch als barbarischer Täter. Da diese Widersprüche unauflösbar sind, lernen die Soldaten (und immer mehr auch Soldatinnen), sie auszuhalten und ihre eigenen Regeln und Normen aufzustellen, die ihnen das Gefühl geben, sich nun ‘für immer’ von der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Militärbefehlshaber kalkulieren ein, dass diese Konditionierung als Zumutung empfunden wird und unterschiedliche Formen verdeckter Verweigerung nach sich ziehen kann. Sie wissen aber auch um die Attraktion, die dieser nicht nur erlaubten, sondern auch gebotenen Grenzüberschreitung innewohnt und die den Kern von immer wieder zu beobachtender ‘Kriegseuphorie’ ausmacht.
Krieg ist (noch?) eine genuin körperliche Angelegenheit, in der Affekte wie Angst und Unlust, aber eben auch Lust aufgerufen werden. Wie sehr Lust an der Gewaltausübung mit sexueller Erregung amalgamiert, lässt sich nicht nur aus dem Subtext von vielen Kriegserzählungen erschließen, sondern wurde und wird von Soldaten aus unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen direkt und unmittelbar geschildert. Der Militärführung ist dieses Phänomen vertraut und es ist Gegenstand unterschiedlicher Regulierungs- und Einhegungsversuche. Gewaltakte, insbesondere sexuelle Gewaltakte, als ‘Kollateralschäden’ verharmlost, gehen in das militärische Kalkül ein, werden zur Waffe, um dem Gegner zu schaden und ihn zu demütigen, und zur in Aussicht gestellten Gratifikation: Frauen als Kriegsbeute, als Mittel der Steigerung von Kampfbereitschaft oder des Aggressionspotenzials. Lediglich unkontrollierte, eigenmächtige, das Kampfziel gefährdende Akte sexueller Gewalt werden als Entgleisung geahndet.
4. Unrechtsempfinden
Zunehmend wird sichtbar, dass der subjektiv erlebte, gewaltsame sexuelle Übergriff auf einen weiblichen, aber auch männlichen Körper – der in unterschiedlichen Formen stattfinden kann, etwa durch die Penetration einer Körperöffnung mit dem Penis oder einem Gegenstand, durch das Erzwingen sexueller Akte zwischen unterworfenen Beteiligten, erzwungener Nacktheit oder das Ausnutzen materieller Notlagen – zugleich ein sozialer Akt ist, dem gegenderte Skripte von Körpern und psychischen Verfasstheiten ebenso zugrunde liegen wie kulturelle Normen von Sexualität und Aggression. Diese zunehmende Sichtbarkeit ist wesentlich dem Umstand zu verdanken, dass sich in jüngerer Zeit überlebende Opfer öffentlich zu Wort melden und, zum Beispiel in der internationalen Rechtsprechung, Gehör finden.
Dieser durch Zeuginnen und Zeugen ausgelöste Prozess öffentlicher Wahrnehmung führt jedoch nicht umstandslos zu einem eindeutigen Problemverständnis und bedarf, um längerfristige öffentliche Aufmerksamkeit, im besten Fall gar präventive Wirksamkeit zu erzeugen oder den Betroffenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der kritischen Ausdeutung. Insbesondere in internationalen und internationalisierten Gerichtsverfahren, aber auch in den Aushandlungsversuchen der Wahrheitsfindungskommissionen wird deutlich, dass das Vorverständnis der Befragenden wesentlichen Einfluss darauf hat, was überhaupt zur Sprache kommt und wie das Ausgesagte, das sich keineswegs von selbst versteht, gedeutet und für die Rechtsprechung relevant werden kann.
Eine normative Übereinkunft darüber zu erreichen, dass sexuelle Gewalt ein zu ahndendes Delikt ist wie andere Gewaltakte auch, und diese normative Übereinkunft rechtlich und politisch abzusichern und einzuklagen, indem die Täter sanktioniert und die Opfer als solche anerkannt werden, ist eine wesentliche Aufgabe, der sich die internationale Rechtsprechung zu stellen versucht. Aber ohne die Anstrengung, die Ausübung von sexueller Gewalt in ihrem sozialen, politischen und vor allem genderpolitischen Bedingungsgefüge einzuordnen und ohne zu erkennen, was an diesem Bedingungsgefüge verändert werden muss, erlangt eine solche Übereinkunft nicht die Wirkungsmacht, um die Praxis sexueller Gewalt nachhaltig zu verändern.