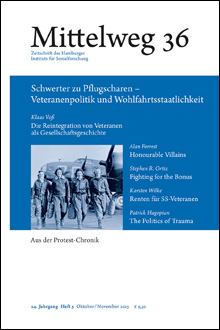Einleitung
Im Juli 2014 veröffentlichte das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) eine erste Langzeitstudie über die gesellschaftliche Reintegration von “Afghanistanrückkehrern” der Bundeswehr. Obschon deutliche Veränderungen im Leben der Befragten der Regelfall waren, betonte die Studie: “Die Soldatinnen und Soldaten kommen zwei Jahre später mit den Beanspruchungen des Einsatzes überwiegend gut zurecht.” Zwar hätten 14 Prozent der Veteranen nach ihrer Rückkehr aus Afghanistan an psychischen Problemen gelitten, doch habe ein deutlich größerer Anteil – mehr als die Hälfte – positive persönliche Veränderungen geltend gemacht und die gebotenen Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung unterstrichen. Die deutschen Medien fanden derart erfreulich verlaufene Reintegrationsprozesse zum Teil “überraschend”. Als im August 2010 einige Afghanistanrückkehrer den Bund deutscher Veteranen ins Leben riefen – die erste Neugründung einer Veteranenorganisation seit den 1950er-Jahren –, fühlte sich die Zeit immerhin zu dem Kommentar genötigt, dass Veteranen “in vielen europäischen Ländern […] etwas ganz Normales” seien. Zivilgesellschaftliches Engagement ehemaliger Soldaten, das sich zudem nicht im politischen Rechtsaußen abspielte, war hierzulande offenkundig etwas Neues. Es sorgte für Irritationen.
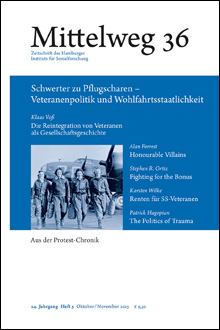
Dass sich gerade die bundesdeutsche Sichtweise auf Veteranen aus spezifischen Erinnerungsarchiven speist, dürfte wenig überraschen. Die Erfahrungen der Weimarer Republik mit radikalisierten Veteranenverbänden und gewaltbereiten Freikorps sind zur einschlägigen Kurzschrift für die prinzipiellen und ernst zu nehmenden Gefahren einer gescheiterten Reintegration geworden. Auch wenn sich massive soziale Wiedereingliederungsprobleme während der Zwischenkriegszeit keineswegs nur in Deutschland eingestellt hatten, betont die jüngere Forschung, dass eine Verengung des Blicks auf die “gefährlichen Veteranen” einen großen Teil der Geschichte, die zu erzählen wäre, ausblendet: Denn nach dem Ersten Weltkrieg setzten sich in der Weimarer Republik wie in ganz Europa gerade Veteranenverbände für die sozialstaatliche Demokratie, den Frieden und internationale Kooperation ein. Auch die Gegenwart liefert immer wieder eindrückliche Beispiele dafür, dass Reintegrations- und Veteranenpolitik mehr sein kann als die bloße Bewältigung von Gefahren und reaktive Eindämmung von Risiken – häufig sogar explizit mehr sein will. US-Präsident Barack Obama, der die sozialstaatliche Versorgung von Veteranen zu einem Grundpfeiler seiner Politik erklärte und einen eigenen Veteranenminister einsetzte, schuf etwa mit seiner Kampagne zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit von Veteranen ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit insgesamt.
Während die Kriege in Afghanistan und im Irak die herausragende Bedeutung einer stimmigen Veteranenpolitik in Europa wie in Nordamerika eingeschärft haben, zeigen die Bemühungen internationaler Organisationen, etwa der Vereinten Nationen und der Weltbank, dass auch in den Konfliktregionen des Globalen Südens große Hoffnungen in das Transformations- und Innovationspotenzial von Wiedereingliederungsprogrammen für ehemalige Kämpfer gesetzt werden. Das Zauberwort (beziehungsweise Akronym) heißt hier “EDR” und steht für wissenschaftlich fundierte Maßnahmenkataloge zur “Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration” ehemaliger Kämpfer. Allein 22 EDR-Programme zwischen dem Ende des Kalten Krieges und dem Jahr 2006 waren der Reintegration von 1,2 Millionen Kombattanten gewidmet. Bei solchen internationalen Initiativen geht es freilich nicht bloß um die Versorgung der Veteranen, sondern um den Umbau kompletter Gesellschaften. Der Politologe Roland Paris charakterisiert derartige Anstrengungen als “nothing less than an enormous experiment in social engineering”, ein Experiment, das, wie er hinzufügt, seit dem Wiederaufbau Japans und Deutschlands nach 1945 nichts Vergleichbares gekannt hat.
Diese Vignetten aus Deutschland, den USA und dem Globalen Süden dokumentieren, dass wir Reintegration nicht auf das geläufige Narrativ des gesellschaftlichen Scheiterns und der individuellen Traumatisierung reduzieren dürfen. Ebenso wie für viele Betroffene das Ende des Krieges und die Phase der Demobilisierung eine Zeit des Neubeginns war, so konnte die Bewältigung der Gefahren und Herausforderungen der Reintegration ehemaliger Kämpfer auch für ganze Gesellschaften als Motor sozialer Innovation und Katalysator politischen Wandels wirksam werden. Die Beiträge dieses Themenhefts wenden sich dieser bis heute eher unterbelichteten Seite umfassender Reintegrationsprozesse zu. Selbstverständlich geht es nicht darum, die offenkundigen Untiefen eines solchen social engineering in Nachkriegszeiten zu überspielen, sondern vielmehr darum, dessen Ambivalenzen zu erkennen und derartige Großversuche in ihrer historischen Bedeutung als windows of opportunity für gesellschaftlichen Wandel zu würdigen. Dazu ist es allerdings erforderlich, den Horizont des 20. Jahrhunderts zu überschreiten, um zu verdeutlichen, dass sich die Geschichte der Reintegration von Kriegern als ein menschheitsgeschichtliches, ja anthropologisches Phänomen über die Neuzeit, das Mittelalter und die Antike bis hin zu prähistorischen Gesellschaften zurückverfolgen lässt. Diese Perspektive gestattet sowohl den Entwurf einer Typologie von Reintegrationsverläufen als auch die Identifikation von fünf zentralen Innovationsfeldern, auf denen sich die gesellschaftlichen Neuerungen abgespielt haben. Mit diesen fünf Bereichen ergeben sich zugleich die Leitmotive dieses Themenheftes, illustrieren sie doch Problem- und Chancenkonstellationen von Reintegrationsprozessen, die durch die Jahrhunderte wiederkehren.
Ein Problem, so alt wie der Krieg
Eine der beliebtesten Fallstudien für Politikwissenschaftler und andere Forscher, die sich mit modernen Reintegrationsprozessen beschäftigen, ist der langjährige Bürgerkrieg in Mosambik (1977-1992). In den 1990er-Jahren erschienen mehrere Forschungsarbeiten, die mit unverkennbarem Enthusiasmus eine (in Wahrheit alles andere als) “neue” Patentlösung zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung ehemaliger afrikanischer Kämpfer vorstellten, nämlich den Rückgriff auf schamanistische Reinigungs- und Geistheilungsrituale. Was an diesem Reintegrationsverfahren augenscheinlich faszinierte, war die dank der Ritualpraxis gegebene Möglichkeit, die ehemaligen Kombattanten mit ihren Dorfgemeinschaften zu versöhnen, einen klar markierten Bruch mit dem kriegerischen Dasein kollektiv zu inszenieren und dabei kulturelle und spirituelle Vorstellungen ins Spiel zu bringen, die von den meisten Mosambikanern geteilt wurden. Weil die Rituale einer autochthonen Tradition entstammen, besaßen sie – im Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen moderner EDR-Programme – den Vorteil, auf kultureller Ebene noninvasiv zu sein. Auch wenn der positive Einfluss archaischer Rituale auf die Konsolidierung des Friedensprozesses möglicherweise von den beobachtenden Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen übertrieben wurde, bleibt doch festzuhalten, dass sie auf breiter Ebene praktiziert wurden und augenscheinlich solide Erfolge zeitigten.
Dass Reintegration im Medium einer Ritualpraxis stattfindet, die sich lebendig gebliebener lokaler Traditionen bedient, ist aus mehreren Gründen interessant. Damit wird erstens deutlich, dass die soziale Wiedereingliederung von Kämpfern weder ausschließlich ein Problem moderner Gesellschaften ist noch die Existenz von Staatlichkeit voraussetzt. Tatsächlich haben Anthropologen für eine Vielzahl akephaler Stammesgesellschaften die Existenz von Reinigungsriten beschrieben, denen sich die Teilnehmer nach dem Ende kriegerischer oder gewalttätiger Auseinandersetzungen unterziehen. Sie nehmen etwa rituelle Waschungen vor, gehorchen bestimmten Speisegeboten oder Auflagen zum Sexualverhalten. Zweitens verweist die Beschaffenheit dieser Rituale auf mindestens zwei Aufgaben, die für die jeweilige Gemeinschaft von Bedeutung sind: Ihre magischen beziehungsweise animistischen Komponenten sollen einerseits die erzürnten Geister der Erschlagenen besänftigen, die der heimkehrende Krieger mit sich zurück in die Dorfgemeinschaft brachte. (Der transhistorische Gehalt, den ein solches Ritual bearbeitet, wird greifbar, wenn man sich verdeutlicht, dass mit den zurückkommenden Kämpfern stets auch Gewalterfahrungen in Familien und Gemeinschaften einkehren, die latent gehalten werden müssen.) Andererseits erfüllen solche Rituale häufig eine ganz konkrete Funktion, die auch modernen Psychologen vertraut sein dürfte. So separierte etwa die polynesische Kultur der Hervey Islands Gruppen von Kriegern für einen festgelegten Zeitraum vom Rest der Gemeinschaft – sie waren tabu. Angesichts des rasanten Aufstiegs der Gruppentherapie im Kontext des Vietnamkrieges dürften Separierungsmaßnahmen, also soziale Arrangements des temporären “Unter-sich-Bleibens” von Veteranen, alles andere als befremdlich wirken. Andere rituelle Auflagen, die in diesen Kontext gehören, lassen sich unzweideutig als Maßnahmen zur mentalen Schonung oder als Indikator für den Grad möglicher Traumatisierung lesen. Die Inuit der Langton Bay im nördlichen Kanada hielten beispielsweise blutige Speisen vom heimkehrenden Kämpfer fern, während ein Zulu-Krieger vor einer Wiederaufnahme in den Stamm seine Fähigkeit unter Beweis stellen musste, mit einer Frau zu schlafen.
Weil es sich bei der sozialen Reintegration durch archaische Kultpraktiken in aller Regel um Purifikationsrituale handelt, liegt ihnen offenbar die Vorstellung zugrunde, dass sich die Kriegsheimkehrer mit etwas beschmutzt haben, folglich unrein zurück nach Hause kommen. Religionswissenschaftler sprechen von einem den Menschen eigenen horror sanguinis, der Furcht vor dem Blut als einer unheimlichen Flüssigkeit mit profanen, etwa auch kontaminierenden wie sakralen Eigenschaften. In vielen Kulturen wurde das Blut an den Waffen von Kriegern als Bindeglied zu den rachsüchtigen Geistern der Erschlagenen wahrgenommen und der Akt des Blutvergießens als eine Tat, die den Krieger selbst gefährdet, ihn nämlich enthemmt und verroht. Von daher wird verständlich, warum, einmal ganz abgesehen von den Ritualen archaischer Gesellschaften, auch vormoderne Maßnahmen zursozialen Reintegration mit kultischem, das heißt religiösem Repertoire operierten. Ein gutes Beispiel liefert die frühmittelalterliche christliche Kriegerbuße, bei der ein Kriegsheimkehrer so viele Tage Buße ableisten musste, wie sich aus der Anzahl der durch ihn getöteten Feinde ergab. Nach der Schlacht von Hastings (1066) erließ die Kirche Bußverordnungen mit geradezu scholastischer Pedanterie: ein Jahr Buße für jeden Getöteten, Sonderauflagen für bewaffnete Schreiber und eine Pauschale für Bogenschützen, die nicht wissen konnten, wen ihre Pfeile getroffen hatten.
Doch ist Reintegration niemals nur ein Fall für Spiritualität und Psychologie gewesen, sie war stets auch ein sozioökonomischer und politischer Prozess. Dies galt insbesondere für staatlich verfasste Gesellschaften, die über die Mittel verfügten, Heere von mehreren tausend Kämpfern aufzustellen. Obwohl in der alteuropäischen Antike die Vorstellung virulent war, das Unheil des Krieges bedürfe ritualisierter Formen innergesellschaftlichen Ausgleichs, haben Athen wie Rom auch die politischen Vorzüge einer öffentlichen Glorifizierung von Veteranen erkannt. Antike Kriegführung in großem Maßstab zog aber vor allem die ersten staatlichen Programme zur Reintegration und materiellen Versorgung von Veteranen nach sich, die uns heute bekannt sind. Mehrere griechische Stadtstaaten führten im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. bereits Vorformen von Veteranenrenten ein. Hervorzuheben ist die athenische Polis, die zur Abwehr von Klientelismus wie zur Sicherung der Demokratie Pensionen an alle körperlich arbeitsunfähigen Bürger (die adynatoi) auszahlte. Dieses historische Faktum lässt erkennen, dass die öffentliche Sorge um die Veteranen schon sehr früh einem explizit politischen Kalkül gehorchte: Es stiftet einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der notwendigen Stabilisierung demokratischer Herrschaft und dem, was erst die Moderne “Sozialpolitik” nennen wird. Gerade dieser Konnex wird für unser Heft von zentraler Bedeutung sein.
Das griechische Altertum ist in mehrfacher Hinsicht ein guter Startpunkt für die Untersuchung von Reintegrationsprozessen als organisiertes gesellschaftliches und politisches Projekt.
Alexander der Große muss unter die Vorreiter auf dem Gebiet der Veteranenpolitik und -versorgung gezählt werden; ohne Zweifel waren seine diesbezüglichen Innovationen unabdingbar für einen Feldherren, der ein multiethnisches Heer über acht Jahre und 18 000 Kilometer zusammenhalten musste. Die zahlreichen von Alexander gegründeten Veteranenkolonien und Garnisonssiedlungen sicherten eroberte Gebiete, dienten mit ihren Landschenkungen an Altersinvaliden und Kriegsversehrte aber auch sozial- und bevölkerungspolitischen Absichten. Derartige Zwecke verfolgten auch die Masseneheschließungen, die Alexander zwischen seinen Veteranen und den Bewohnerinnen besetzter Regionen arrangieren ließ, sowie die von ihm erlassene Vorschrift, dass Veteranen in ihrer jeweiligen Heimatstadt wieder aufgenommen werden mussten.
Es waren allerdings die römische Republik und das spätere Prinzipat, die Altersversorgung und Sozialpolitik dauerhaft mit der militärischen und politischen Sicherung von Herrschaft verknüpften. Während römische Veteranenkolonien bis zum frühen 2. Jahrhundert v. Chr. als funktionales Äquivalent für stehende Heere gedient und die Außengrenzen der Republik gesichert hatten, wurden sie spätestens mit der marianischen Heeresreform (107 v. Chr.) zu Ortschaften, wo sich die verarmte städtische Unterschicht ansiedeln konnte. Damit verfügten römische Feldherren über ein Instrument, mit dem sie sich der Loyalität ihrer Soldaten über den Zeitpunkt von deren Entlassung hinaus versichern konnten. Unter Kaiser Augustus entstanden schließlich die Vorläufer eines Rentensystems: Ehrenhaft entlassene Veteranen konnten zwischen der missio nummeria (einer festen Geldsumme, die anfangs 12 000 Sesterzen betrug) und der missio agraria (einem Stück Land zur selbständigen Bewirtschaftung) wählen. Hinzu kamen weitere Privilegien wie die Befreiung von Steuern sowie das Eherecht und die Einbürgerung für Mitglieder der nichtrömischen Auxiliartruppen.
Das kurze Schlaglicht auf die Situation in tribalen Gesellschaften wie der ausgesprochen kursorische Querschnitt durch die Altertumsgeschichte illustrieren, dass wir es bereits vor Beginn der europäischen Neuzeit mit einer Vielzahl komplexer, häufig multifunktionaler und innovativer Praktiken zu tun haben, die – in wie abgewandelter Form auch immer – selbst heute noch eine tragende Rolle bei der Reintegration von Kriegsteilnehmern spielen. Gleichwohl ist es vor allem der neuzeitliche Staat, dessen historisches Schicksal eng mit den gesellschaftlichen Problemlagen verknüpft ist, die zu bewältigen sind, soll die Reintegration und Versorgung von Veteranen gewährleistet werden. Angesichts des durchaus heterogenen empirischen Materials stellt sich die Frage, wie die unterschiedlichen Facetten sozialer Reintegration am besten zu ordnen sind.
Gefahren und Chancen: Eine Typologie der Reintegration
Das von den Vereinten Nationen herausgegebene, knapp 800-seitige Handbuch für EDR-Programme in der “Dritten Welt” definiert “Reintegration ” folgendermaßen:
Reintegration is the process by which ex-combatants acquire civilian status and gain sustainable employment and income. Reintegration is essentially a social and economic process with an open time-frame, primarily taking place in communities at the local level. It is part of the general development of a country and a national responsibility, and often necessitates long-term external assistance.
Diese Definition beruht auf einem ganzen Bündel an Prämissen, die aus historischer Sicht keineswegs universelle Gültigkeit besitzen, und ignoriert dabei zentrale Fragen. Sie geht von einer klaren Trennung zwischen zivilem und militärischem Leben aus, setzt internationale Unterstützung als Regelfall voraus, blendet die Rolle des Staates zugunsten sogenannter Communities aus und reduziert die Zielsetzung von Reintegration auf sozioökonomische Faktoren wie einen beständigen Arbeitsplatz und ein regelmäßiges Einkommen. Gerade dieser letzte Aspekt ist unter definitorischer Hinsicht besonders fragwürdig, muss Wiedereingliederung in Wahrheit doch stets auf verschiedenen Ebenen gelingen. Neben der sozioökonomischen Ebene wäre etwa die bereits thematisierte psychische und kulturelle Integration zu bedenken, zu der die geistige Abrüstung, die therapeutische Betreuung und die “Rezivilisierung” eines ehemaligen Kämpfers gehören. Nicht minder bedeutsam ist die politische Seite von Reintegration, die Anerkennungsrituale, Statusfragen und Verwaltungskunst, vor allem aber die Einbindung von Veteranen in den politischen Prozess sowie in die Zivilgesellschaft umfasst.
Anstatt den Vorgang auf eine simple Formel zu reduzieren, ist es ratsam, unter Reintegration einen mehrdimensionalen Prozess zu verstehen, der sich gewöhnlich in einem Spannungsfeld von spezifischen Gefahren auf der einen und gesellschaftlichen Innovationschancen auf der anderen Seite abspielt. Erwartungsgemäß hat sich der weitaus größere Teil der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit auf die Analyse der Risiken und Gefährdungen konzentriert. Mehr noch, die Identifikation von Veteranen als einer potenziell gefährlichen, in jedem Fall aber politisch überdurchschnittlich bedeutsamen Bevölkerungsgruppe hat bisher in aller Regel den Anstoß zu deren Erforschung geliefert.
Tatsächlich prägt diese eindimensionale Sichtweise, die geradezu erkennungsdienstliche Behandlung ehemaliger Kämpfer als ein zu entschärfendes Sicherheitsrisiko, die internationalen EDR-Programme der Vereinten Nationen und der Weltbank bis auf den heutigen Tag. Dabei lassen sich die meisten historischen Fallstudien zu den Folgen unzureichender Reintegration oder gescheiterter Veteranenpolitik einer von mehreren Gefahren zuordnen, die mit archetypischer Macht die Wahrnehmungen der Veteranenforschung bestimmen.
Besonders prominent ist die Überzeugung, dass Veteranengruppen eine politische Gefahr für die Regierungen darstellen, zumal in so instabilen historischen Zeiten wie den Nachkriegsphasen. Staatsstreiche und Verschwörungen desillusionierter oder radikalisierter Veteranen sind ein in der Geschichtsschreibung geläufiger Topos. Man denke etwa an den Kapp-Putsch von 1920, die Newburgh-Verschwörung der Amerikanischen Revolution 1783, den Algier-Putsch gegen Charles de Gaulle von 1961 oder an die Rolle der Prätorianergarde im alten Rom. Marodierende Gruppen von Veteranen gelten in etwas weiter gefasster Perspektive zudem als eine Gefahr für das staatliche Gewaltmonopol überhaupt. Die wiederkehrenden Auftritte plündernder Landsknechte und Söldnertruppen, die sich nach einem Krieg nicht mehr unter Kontrolle bringen ließen, bedingte im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa sogar die Gründung der ersten stehenden Heere, etwa durch Karl VII. von Frankreich (1402–1461). Auch in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts gefährdete eine Welle paramilitärischer Gewalt staatliche Gewaltmonopole von Finnland bis ins Osmanische Reich sowie von Irland bis in die Ukraine – und nach 1945 drohte die Demobilisierung sowjetischer Veteranen zeitweise außer Kontrolle zu geraten.
Nicht alle Gefahrtypen bedrohen den Staat oder eine Regierung unmittelbar. Die ökonomische Gefahr der Massenarbeitslosigkeit und Verarmung von Veteranen ist ein Phänomen, das sich im Anschluss an nahezu alle größeren Kriege der Neuzeit einstellte. Bis zu den Napoleonischen Kriegen (und zum Teil noch darüber hinaus) setzte die Bevölkerung der meisten Staaten Europas den Veteranen mit einem Vagabunden oder Bettler gleich. Britische Gemeinden gaben sogar gesonderte Bettellizenzen für ehemalige Soldaten heraus.
In den amerikanischen Südstaaten gehörten arbeitslose und verarmte Veteranen nach dem Bürgerkrieg so sehr zum Stadtbild, dass sie zum einschlägigen Symbol des Lost Cause wurden und zu einer prägenden Sozialfigur der Reconstruction-Ära nach 1865. Dass es sich dabei nicht um eine poetische Fiktion handelte, bezeugen schon allein die über 220 000 körperlich schwer versehrten konföderierten Veteranen, die den verarmten Süden vor ein beträchtliches wirtschaftliches Problem stellten. Eine Unzahl arbeitsloser Veteranen lässt sich auch in der Zeit zwischen den Weltkriegen als gravierende makroökonomische Belastung ausmachen. Sie beschäftigte keineswegs nur die Weimarer Republik, sondern auch Großbritannien (mit allein 300 000 arbeitslosen Veteranen im Jahr 1920) und die USA, wo in den 1930er-Jahren bis zu 62 Prozent der drei Millionen bei der Veterans Administration registrierten Exsoldaten arbeitslos waren.
Assoziiert mit Pauperisierung ist in aller Regel auch die Gefahr der Kriminalität. Im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts waren Banditentum, Wegelagerei, Diebstahl, Betrug, Alkoholismus und andere Formen der Lasterhaftigkeit untrennbar mit dem Bild vom entlassenen Soldaten verknüpft. In den USA stellten Veteranen nach dem Bürgerkrieg in vielen Gefängnissen mehr als zwei Drittel der Insassen. Auch heute führen die Vereinten Nationen den Drogen- und Waffenhandel im südlichen Afrika und in Lateinamerika zu Teilen auf einen “ex-combatant criminal nexus” zurück.
Mordwellen und gewalttätige Bandenkriminalität, wie sie beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien oder der Sowjetunion im Zusammenhang mit Kriegsveteranen erkennbar waren, deuten auf eine weitere Bedrohung hin: die Gefahr der Gewaltkulturen. Diese Gefahr muss nicht zwingend in der vielgesichtigen Gestalt strafrechtlich sanktionierter Verbrechen auftreten, kann vielmehr als allgemeine Verrohung, Brutalisierung oder Militarisierung des sozialen Alltagslebens in Erscheinung treten, die dann nicht zuletzt den Veteranen zugeschrieben wird. In diesen Kontext gehören die von dem Historiker George L. Mosse für die europäische Zwischenkriegszeit aufgestellte “Brutalisierungsthese”, aber auch empirische Phänomene wie der signifikante Aufstieg der US-amerikanischen Milizbewegung und die Ausbreitung paramilitärischer Subkulturen nach dem Vietnamkrieg. Zu erwähnen wäre zudem Frank Reichherzers Konzept einer “Bellifizierung” der deutschen Kultur nach dem Ersten Weltkrieg, ebenso wie die angloamerikanischen Ängste vor einer durchgreifenden Faschisierung der eigenen Gesellschaft durch die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommenden Soldaten.
In fast allen der einem Sample von 450 Titeln entnommenen Monografien und Aufsätze, die sich mit Veteranen und ihrer Wiedereingliederung befassen, findet sich eine oder mehrere der aufgelisteten Gefahren. Doch enthüllt das Studium dieser reichhaltigen Literatur auch, dass uns die Geschichte der Reintegration stets noch ein zweites Gesicht zeigt, das die Spuren der Anstrengungen trägt, die unternommen wurden, um gesellschaftlichen Herausforderungen nicht zuletzt durch die Schaffung neuer institutioneller Arrangements zu überwinden. Im Folgenden sollen die fünf Felder vorgestellt werden, auf denen sich solche Innovationen verorten lassen.
Landverteilung und Siedlungspolitik
Die biblische Friedensverheißung im Buch des Propheten Jesaja (2, 3-4) prophezeit das Ende des Krieges unter den Völkern. Schwerter würden zu Pflugscharen und Spieße zu (Baum-)Sicheln umgeschmiedet. Das Gleichnis verweist auf eine kreative Umwandlung der materiellen Hinterlassenschaften des Krieges in für die Menschen nutzbringende Werkzeuge. Zwar berührt die Parabel in ihrem Kern viele geschichtlich ersonnene Methoden der Reintegration ehemaliger Kämpfer, passt auf den ersten Blick jedoch besonders gut zu einer der ältesten Strategien, die uns beim Blick auf das antike Rom und die Feldzüge Alexanders bereits begegnet ist. Gemeint sind die Verteilung von Agrarparzellen, die Erschließung und Kultivierung von Ackerland sowie die Gründung neuer Siedlungen. Von der Metamorphose des Kriegers in einen Bauern scheint gerade im abendländischen Kulturkreis eine Faszination auszugehen, die alle Epochen übergreift. Sie entspringt zweifelsohne dem Assoziationsfeld, das bäuerliche Lebensformen in ihrer pastoralen Friedlichkeit aufrufen. Der Landwirt ist sesshaft, kultiviert den Acker, kümmert sich um die Aufzucht der Tiere, versorgt seine Familie – er pflanzt an, schafft neues Leben.
So kann es eigentlich nicht überraschen, dass (Agrar-)Utopien ein konstantes, historisch immer wiederkehrendes Bestandsstück visionärer Reintegrationspläne gewesen sind, die nach großen, transformativen Kriegen entworfen wurden. Zu Beginn der Amerikanischen Revolution verabschiedete der Kontinentalkongress ein Gesetz, das Rekruten für den bewaffneten Kampf gegen die Krone Ackerland versprach. Regulären Soldaten wurden 100 Acres Land, Offizieren 500 Acres in Aussicht gestellt.
Thomas Jeffersons revolutionäres Ideal einer Gesellschaft von wehrhaften Farmern wirkte weit bis ins 19. Jahrhundert fort: Auch für die Teilnehmer am Krieg von 1812 und für die Soldaten des Kriegs gegen Mexiko (1846-1848) vergab die Regierung Landgarantien. Bis 1860 erhielten immerhin rund 500 000 Veteranen, ihre Angehörigen und Erben insgesamt über 60 Millionen Acres an Landparzellen.
Wie die amerikanischen Gründerväter vor ihm ließ sich auch Napoleon durch römische Vorbilder inspirieren. Im geistigen Grenzland zur Utopie, so der Historiker Isser Woloch, entwarf Bonaparte 1802 einen Plan zur Gründung von fünf Veteranensiedlungen à jeweils 400 Mann im Piemont und im Rheinland. Ähnlich wie die römischen Veteranensiedlungen in Numidien sollten sie zu Kornkammern seines Reiches werden, zugleich aber auch Keimzellen einer tugendhaften Gesellschaft sein. Das kühne Unterfangen kam nie über eine Pilotphase von zwei Siedlungen hinaus, doch blieben Pläne für Landzuteilungen an Veteranen von der Revolutionszeit bis zum Ende der Napoleonischen Ära ein beständig wiederkehrendes Thema in Frankreich. Insgesamt tauchen derartige Reintegrationsprojekte regelmäßig dann auf, wenn wehrhafte Gesellschaftsutopien die Kriegführung ideologisch unterfüttern – so übrigens auch bei den Nationalsozialisten, die bekanntlich Landparzellen in “volkstumsgefährdeten Gebieten” an Veteranen und Kriegsversehrte verteilten.
Die Verwandlung von Soldaten in ackerbauende Landwirte ist folglich alles andere als unschuldig. Weit davon entfernt, ein friedliches Landleben herbeizuführen, war sie zumeist ein Mittel der territorialen Expansion und gezielter Verteidigungspolitik. Schon die römischen Veteranenkolonien legten sich in den unsicheren Grenzgebieten wie ein Ring um die verwundbaren Kernlande des Imperiums. Indem römische Auxiliartruppen nach ihrer Entlassung nicht nur die missio agraria, sondern auch die römische Staatsbürgerschaft erhielten, wurde ihr bäuerliches Dasein mit der Sicherheit eroberter Territorien verknüpft.
Veteranen als Landbesitzer sind gleichermaßen in den Staat investiert und ihrerseits eine Investition des Staates. Das gilt beileibe nicht nur für die antike Geschichte, denn auch für die Expansion und den Machterhalt der europäischen Imperien spielten Veteranen als loyale und wehrfähige Siedler vom 17. bis ins 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Sowohl die Briten wie die Franzosen verteilten seit den 1660er-Jahren in Neufrankreich und dem späteren Kanada Land an entlassene Soldaten. Der strategisch bedeutende Hafen von Halifax wurde 1749 zu einer Veteranenkolonie, gefolgt von weiteren Siedlungen am St.-Lorenz-Strom, in Nova Scotia und New Brunswick.
Derartige Querverweise auf die Geschichte des europäischen Imperialismus lassen sich auch für die Zeit nach den Napoleonischen Kriegen formulieren, als Wellingtons und Bonapartes Veteranen neue Siedlungen und Gemeinden in Nord- wie Südamerika, in Australien und Neuseeland, sogar im Rheinland gründeten. Solche Ansiedlungen dienten neben der Verteidigung stets auch der sozialen Kontrolle (etwa von aufrührerischen Kolo-nisten). Zudem hatten sie eine ökonomische Funktion, waren nämlich ein Ventil, das die Armut in der Metropole abmilderte – insofern ist die Siedlungspolitik ein besonders vielseitiges Instrument der Reintegration von Veteranen gewesen. Im britischen Empire gewannen diese bevölkerungs- und sozialpolitischen Maßnahmen nach 1815 kontinuierlich an Bedeutung. So ermutigte die Londoner Regierung mit dem “Free Passage Scheme” Zehntausende entlassener Soldaten zur kostenlosen Emigration in die Kolonien und Dominions. Kanada, Australien und Südafrika entwarfen in der Zwischenkriegszeit eigene Siedlungspläne für Veteranen, die ebenfalls nicht nur Land erschließen, sondern auch den Arbeitsmarkt entlasten sollten. All dies zeigt: Solche Landverteilungs- und Migrationspolitiken gehören zum Standardrepertoire der Reintegrationsgeschichte, auf das bis heute im Rahmen von großangelegten EDR-Programmen der Vereinten Nationen zurückgegriffen wird – freilich stets präsentiert mit einem Gestus der Innovation.
Renten und Wohlfahrtsstaatlichkeit
Während die Verteilung von Land wechselseitig die Interessen von Gebern und Nehmern befriedigte, begannen im Europa der Neuzeit die Staaten erstmals damit, finanzielle und kurative Verantwortung für Veteranen, insbesondere für Kriegsinvaliden, zu übernehmen. Der erste europäische Rentenplan für Veteranen ist das britische County Pension Scheme von 1593 gewesen. Durch die Zeit des Englischen Bürgerkrieges (1642–1649) hindurch wurden in Großbritannien Grundfragen staatlicher Fürsorge wie in einem historischen Laborversuch ausgehandelt. Entscheidend für die Berechtigung zu einer Pension war anfangs nur die Verwundung im Kampf, später der Nachweis einer tatsächlichen Arbeitsunfähigkeit. Die wechselnden Regierungen von Parlamentariern und Royalisten begriffen Mitte des 17. Jahrhunderts schnell, dass Veteranenrenten nicht nur die Loyalität der eigenen Anhängerschaft sicherten, sondern sich auch günstig auf die Anwerbung von Rekruten sowie die Vermeidung von Desertionen auswirkten. Sie erfüllten somit sowohl eine politisch legitimierende als auch eine militärische Funktion. Zudem markierte die Einführung der Veteranenrente einen ebenso umstrittenen wie historisch folgenreichen Bruch mit herkömmlichen Formen der Mildtätigkeit: Sie war eine Anspruchsleistung, die zwar Bedürftigkeit voraussetzte, letztlich jedoch für den Staat geleistete Dienste honorierte.
Die Veteranenrenten hatten eine andere Qualität als Almosen für Verarmte und Versehrte oder die im 18. Jahrhundert verbreitete Praxis, demobilisierten Offizieren weiterhin den halben Sold zu zahlen, um sie verfügbar (und die Armee funktionstüchtig) zu halten. Wie sich im revolutionären und napoleonischen Frankreich zeigen sollte, verschoben die politischen Aushandlungsprozesse von Veteranenrenten die “frontier of social welfare”. Als eine Vorform von Wohlfahrtsstaatlichkeit bezeugen sie einen signifikanten ideengeschichtlichen Wandel. In ihnen kündigte sich das neue politische Konzept einer staatlich umsorgten Solidargemeinschaft an, das offenkundig in das legislative Arsenal der Französischen Revolution eingeflossen ist. Entscheidend ist das Gesetz vom 6. Juni 1793, das einfache Soldaten betraf und die Beziehung zwischen Bürger und Staat neu konfigurierte. Insbesondere handelte es sich um zwei gewichtige Innovationen. Erstens favorisierte das Gesetz egalitaristische gegenüber meritokratischen Kriterien – Offiziersrang und Dienstzeit waren weniger bedeutsam als die Schwere der individuellen Verwundungen. Zweitens führte es Witwen- und Hinterbliebenenrenten ein, war somit ein, auch nach modernem Verständnis, sozialstaatliches Instrument. Als solches blieben die französischen Veteranenrenten bis zum Ende der Revolution und der Napoleonischen Ära umstritten. Sie mussten kontinuierlich neu verhandelt werden. Zwar wurde die Rentengesetzgebung für Veteranen unter Napoleon revidiert und auf ein niedrigeres Niveau abgesenkt,
doch hatte sich ein bemerkenswerter Durchbruch ereignet: Der Staat hatte eine institutionell kodifizierte Verantwortung für die Versorgung bestimmter Gruppen von Bürgern anerkannt.
Die tektonische Verschiebung in Richtung Sozialstaatlichkeit, die durch die Einführung von Veteranenpensionen in Westeuropa initiiert wurde, beschränkte sich freilich nicht auf die Alte Welt. Im 19. Jahrhundert sind die Vereinigten Staaten von Amerika der wichtigste Vorreiter bei der staatlichen Versorgung von Veteranen und ihren Familien gewesen. Der Revolutionary War Pension Act von 1818 war ein Meilenstein auf diesem Weg. Mehr als 25 000 Veteranen des Revolutionskrieges und des Krieges von 1812 sowie 47 000 ihrer Angehörigen wurden kraft dieses Gesetzes finanziell versorgt. Seine Kosten verschlangen 16 Prozent des US-amerikanischen Bundeshaushaltes und überschritten mit 75 Millionen Dollar die Summe, die zur Finanzierung des Revolutionskrieges aufzubringen war. Die USA standen am Rande des Staatsbankrottes.
Auch jenseits des Atlantiks führte das ins Auge gefasste Rentenprogramm zu heftigen Kontroversen. Sie betrafen nicht zuletzt das normative Fundament der US-amerikanischen Gesellschaft. Seine Gegner argwöhnten, eine Berentung von Veteranen würde die für ein republikanisches Gemeinwesen unverzichtbaren staatsbürgerlichen Tugenden unterminieren, also etwa den Patriotismus und die Opferbereitschaft gefährden. Gegen solche Vorbehalte setzten sich jedoch ein kollektives Gefühl nationaler Dankbarkeit und die geteilte Wahrnehmung einer moralischen Verpflichtung durch. Gleichwohl ließ sich die genuin US-amerikanische Vorstellung, wonach self-reliance zu den Grundwerten einer ethisch legitimen Lebensform gehört, nur durch eine Sozialfigur irritieren, in der sich individuell unverschuldete Armut mit Verdiensten um das Gemeinwesen vereint – dieses Bild des deserving poor lieferten die Veteranen. Deren Bedürftigkeit ermittelte der sogenannte means test, ein Prüfungsverfahren, das sicherzustellen hatte, dass die Voraussetzungen für den Erhalt der Pension gegeben waren. Mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg und den Pensionsgesetzen von 1862, 1879 und 1890 wurden Veteranenrenten zu einem flächendeckenden Instrument der nationalen Versorgungspolitik. Es beanspruchte mehr als ein Viertel des Bundeshaushaltes und diente zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Praxis zunehmend der materiellen Absicherung von Alten und Witwen. Wie die Soziologin Theda Skocpol anmerkt, trennen sich an dieser Stelle die Entwicklungslinien europäischer und US-amerikanischer Sozialstaatlichkeit. Während sich in Europa ein System zur Absicherung des (männlichen) Arbeiters als Versorger und Mittelpunkt der Familie bildete, wurde in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts der Veteran zunehmend von der Mutter als Referenzpunkt des Rentensystems verdrängt. Gleichwohl betont auch Skocpol die Bedeutung von Veteranenpensionen als ersten Entwurf eines amerikanischen Sozialstaates.
Im Zeitalter der Weltkriege war die Versorgung von ehemaligen Soldaten bereits fester Bestandteil des zivilmilitärischen Verhältnisses zwischen Bürger und Staat. Die Mobilisierung (und Demobilisierung) von Millionenheeren trieb die finanziellen Anforderungen an die nationalen Haushaltspolitiken freilich drastisch in die Höhe. Eine riskante Antwort auf dieses Problem war es, Zahlungen für Veteranen bei einer klammen Budgetsituation in die ferne Zukunft zu verschieben. Die US-Regierung garantierte beispielsweise ihren Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg in einem Gesetz von 1924 die Auszahlung sogenannter Bonuszertifikate im Jahr 1945. Die Aussicht auf eine vorgezogene Auszahlung dieses Geldsegens befeuerte die großangelegten Veteranenproteste der Depressionsära. Diese kulminierten schließlich 1932 in einem Protestmarsch von 40 000 Veteranen auf Washington, den Präsident Hoover gewaltsam niederschlagen ließ. Der Zweite Weltkrieg brachte hingegen eine ganze Reihe von sozialstaatlichen Gesamtkonzepten hervor, die über die bloße Auszahlung von “Kriegerrenten” hinausgingen. Die amerikanische GI Bill of Rights (1944), das deutsche Bundesversorgungsgesetz für unterschiedliche Arten von Kriegsgeschädigten (1950) und der britische National Health Service Act (1948) illustrieren diesen Trend zu breiter angelegten und aufeinander abgestimmten Maßnahmen zur Reintegration der Veteranen und Bewältigung von Kriegsfolgen.
Verwaltungskunst und Expansion von Staatlichkeit
An der Institutionalisierung des britischen National Health Service lässt sich exemplarisch ablesen, wie untrennbar die Entstehung eines ausdifferenzierten, modernen Gesundheitswesens in vielen westlichen Staaten mit der Veteranenpolitik und -versorgung verbunden war. Ihren Ausgang nahm diese lange Entwicklung von der Errichtung der großen Veteranenhospitale in Großbritannien und Frankreich, die als Prestigeprojekte der jeweiligen Monarchen zwischen 1676 und 1692 erbaut wurden. Diese Prachtbauten, das britische Royal Chelsea Hospital und das Greenwich Hospital in London sowie das Pariser Htel des Invalides, waren weit mehr als reine Militärkrankenhäuser. In ihrer Kernfunktion beherbergten sie mehrere tausend Kriegsinvaliden, die dort nicht nur ärztlich betreut wurden, sondern – wie in Altenheimen – dauerhaft wohnten, militärischem Zeremoniell folgten und einfache Arbeiten verrichteten. Darüber hinaus übernahmen diese Einrichtungen jedoch treuhänderische Aufgaben für den Staat, darunter die medizinische Dokumentation von Rentenansprüchen und die Auszahlung der Pensionen.
Ähnliches gilt für das US-amerikanische System der Soldatenheime (soldier homes), das 1865 begründet wurde. Unter dem Oberbegriff “National Home for Disabled Volunteer Soldiers” versorgte ein Netzwerk von elf Zweigstellen um 1900 mehr als 100 000 Unionsveteranen. Die Südstaaten unterhielten ihre eigenen Heime, die ebenfalls komplexe Aufgaben der Dokumentation, Verwaltung und Verteilung staatlicher Unterstützungsleistungen erledigten. Aus der Struktur der Veteranenheime entstand 1930 dann die Veterans Administration (kurz: VA). Die VA verwaltete 1946 rund 1,5 Millionen Veteranen, hatte 173 000 Mitarbeiter, 753 Field Offices und 97 Hospitäler in 48 Bundesstaten. Sie bearbeitete täglich 250 000 Postsachen und war mit einem Budget von einer halben Milliarde Dollar die größte und teuerste Bundesbehörde der USA.
Gerade die USA liefern ein herausragendes Beispiel dafür, dass letztlich Notwendigkeiten der Veteranenpolitik die Expansion von Staatsaufgaben und den Ausbau komplexer Bürokratien und Verwaltungssysteme vorangetrieben haben. Der Zweite Kontinentalkongress verabschiedete bereits zwischen 1778 und 1780 erste Pensionspläne für Offiziere, die mit ihrem Kostenvolumen von rund einer halben Million Dollar langfristig eine deutliche Erhöhung der finanziellen Beiträge der Einzelstaaten zum Bundeshaushalt erzwangen. Föderalisten wie Alexander Hamilton benutzten die Veteranenpolitik als ein Vehikel, um die Finanzressourcen einer zentralen Exekutive auszuweiten und damit selbstverständlich auch deren Handlungsspielräume zu erweitern. Für diese Verfechter einer Zentralisierung staatlicher Macht war völlig klar, dass sich mit der Verabschiedung solcher Pensionsgesetze zugleich die Frage einer nationalen Besteuerung stellte.
Für das ganze 19. Jahrhundert lässt sich eine massive Ausweitung der staatlichen Verwaltungsorgane beobachten, die in den bürokratischen Erfordernissen der gesundheitlichen und materiellen Veteranenversorgung begründet liegt. Bemerkenswerterweise werden im Rahmen solcher Expansionsprozesse aber auch schon frühe Formen von Public-Private-Partnerships sichtbar, wie etwa die US Sanitary Commission, die 1861 als eine Art private Reintegrationsbehörde zur Welt kam, später jedoch in öffentliche Institutionen überführt wurde. Nach dem Bürgerkrieg stieg das Pension Bureau, das die Veteranenrenten verwaltete, zur drittgrößten Behörde der Regierung auf – nur noch übertroffen vom Finanz- und Postministerium. Das 1887 für die astronomische Summe von 900 Millionen Dollar erbaute Pension Building in Washington, inoffiziell auch als der “Rentenpalast” bekannt, wurde mit seinen imposanten Marmorhallen, Säulen, Friesen und Ornamenten zu einem weithin sichtbaren Symbol des wachsenden staatlichen Verwaltungsapparates.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, blieben die Versorgungsansprüche gewöhnlicher Soldaten bis ins 20. Jahrhundert an bestimmte medizinische Voraussetzungen wie Invalidität oder Unfähigkeit zu körperlicher Arbeit gekoppelt. Und selbst wenn diese Kriterien der Anerkennung von Rentenansprüchen nicht zugrunde lagen, musste der Veteran in der Regel seine finanzielle Bedürftigkeit nachweisen. Solche Ansprüche zu prüfen und zu dokumentieren verlangte nicht nur nach beträchtlichen bürokratischen Ressourcen. Zudem waren Fortschritte in der Verwaltungskunst und in der Technik des record-keeping, also der immer umfassenderen Anlage von Akten über einzelne Bürger, nötig. Erste einigermaßen anspruchsvolle Dokumentationsverfahren mit beglaubigten Briefen von Feldscheren und Offizieren, Aussagen von Zeugen sowie Gutachten von Friedensrichtern wurden bereits nach dem Englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert angewandt – für Historiker sind die ungewöhnlich detaillierten Unterlagen bis heute eine Fundgrube.
Die Sammlung medizinischer Akten über die Veteranen des Amerikanischen Bürgerkrieges durch die Surgeon General’s Records and Pension Division, bei der alle Antragsteller vorzusprechen hatten, wurde mit ihren mehreren hunderttausend Einzelfallakten zu einem der größten Informationsarchive, die Staaten bis dato über ihre Bürger angelegt hatten. Auch die bereits erwähnte Wohlstandsprüfung (means test) für die Rentenansprüche von Teilnehmern des Unabhängigkeitskrieges erzeugte einen Aktenbestand, der ein feinkörniges Bild der Besitzverhältnisse und Einkünfte der Revolutionsgeneration vermittelt. Natürlich wäre er ohne einen aufwendigen bürokratischen Apparat nie zustande gekommen. Ganz ohne Frage hat sich die staatliche Bürokratie aber nicht nur in den USA extrem vergrößert. Vielmehr hat der Historiker Michael Geyer nachgewiesen, wie stark gerade die Kriegsopferversorgung nach dem Ersten Weltkrieg die Bürokratien und Verwaltungsinstitutionen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien für Jahrzehnte aufgebläht hat.
Arbeitsmarkt und Bildungswesen
Es waren nicht selten die Veteranen selbst, die Stellen in den anwachsenden staatlichen Verwaltungsorganen besetzten. Eine überschaubare Anzahl von Berufen und Aufgaben stand für solche neuzeitlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verfügung: Hierzu gehörten erstens Büroarbeiten aller Art, also beispielsweise Aktenverwaltung und Korrespondenz. Veteranen arbeiteten als Protokollanten und Schreiber, als Sekretäre, Buchhalter und Sachbearbeiter bei Gericht, in Ministerien und lokalen Amtsstuben. Sie wurden zweitens im Post- und Meldewesen eingesetzt, bei körperlichen Einschränkungen vorzugsweise stationär als Telegrafisten oder an den Schaltern von Postämtern. Drittens eigneten sie sich für einfache Wach- und Aufsichtstätigkeiten als Torwächter, Parkwächter oder Wachpersonal in Verwaltungsgebäuden. Im Zeitalter des Nationalismus (und bis ins 20. Jahrhundert) schrieb man Veteranen zudem eine hohe Eignung als Lehrer zu – Staatsbürger, die ihre Opferbereitschaft für nationale Anliegen unter Beweis gestellt hatten, sollten die geistige Formung der nachwachsenden Generationen übernehmen. Zu diesen vier klassischen Professionsfeldern kamen diverse kleinere Aufgabenbereiche hinzu, die ebenfalls dem Staat oblagen: Ehemalige Soldaten erhielten Anstellungen als Pestwächter, Gefängnisaufseher, Quartiermeister, Forst- und Landinspektoren oder Träger in Hospitälern. Arbeitsbeschaffungsprogramme dieses Typs lassen sich in Westeuropa und den USA für den Englischen Bürgerkrieg, die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege, den Amerikanischen Bürgerkrieg und die beiden Weltkriege belegen.
Die beschriebenen klassischen Förderungsmaßnahmen ergänzten also die staatliche Arbeitsmarktpolitik bis ins 19. und 20. Jahrhundert. Um die Wende zum vergangenen Jahrhundert trat zudem mit der Einrichtung (halb) privater und staatlicher Arbeitsagenturen ein neuer institutioneller Akteur auf den Plan, dessen Entstehungsgeschichte ebenfalls eng mit der Veteranenpolitik verknüpft ist. Die britischen Labour Exchanges, die 1909 per Gesetz als allgemeine Arbeitsvermittlungen eingerichtet wurden, orientierten sich am Modell der zahlreichen privaten und wohltätigen employment agencies für Offiziere und ehemalige Soldaten, die seit den 1880er-Jahren existierten. Obwohl in den Dienst für die Bevölkerung insgesamt gestellt, gewährten die Labour Exchanges den Veteranen eine Vorzugsbehandlung gegenüber Zivilisten. Auch Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland führten nach dem Ersten Weltkrieg spezielle Quotenregelungen für die Vermittlung von Kriegsversehrten ein. Immerhin vermittelte das Emergency Employment Committee des US-Kriegsministeriums bis 1919 rund eine Million Veteranen an ihre neuen Arbeitgeber.
Noch umfassendere Maßnahmen zur Steuerung des Arbeitsmarktes und zur ökonomischen Reintegration von Veteranen ergriffen Großbritannien und die USA jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das britische Arbeitsministerium richtete den Resettlement Advice Service mit 370 Amtsniederlassungen ein, der allein im ersten Nachkriegsjahr von 2,5 Millionen Veteranen genutzt wurde. Mit dem Reinstatement in Civil Employment Act von 1944 garantierte die Londoner Regierung jedem heimkehrenden Soldaten seinen alten Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen in derselben Firma. Die USA unterhielten in der unmittelbaren Nachkriegszeit sogar fünf verschiedene Behörden, die ganz oder teilweise mit der Beratung und Jobvermittlung für Veteranen befasst waren. Allein der sogenannte Selective Service schuf 10 000 Beratungsstellen für Veteranen; der US Employment Service 1 500 neue Vermittlungsbüros.
Die schon wegen ihrer Vielzahl beeindruckenden staatlichen Initiativen, Beschäftigung einerseits effizienter zu vermitteln, andererseits aber auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, waren eng mit einer weiteren Dimension der Reintegrationspolitik verknüpft, nämlich der Förderung von Bildung und Wissenschaft. Die Versuche, aus Soldaten nunmehr Schreiber, Lehrer und Staatsdiener zu machen, setzten im Mindestfall eine Alphabetisierung voraus. So hatte das Pariser Htel des Invalides bereits 1797 eine Schule für Veteranen und Kriegswaisen eingerichtet, deren Lehrkräfte neben dem Lesen und Schreiben auch Grundrechenarten, Geschichte und Staatsbürgerkunde unterrichteten. Umgekehrt wurden die Veteranenhospitäler, Soldatenheime und Rehabilitationszentren aufgrund ihrer therapeutischen Aufgabenstellungen zu fruchtbaren Zentren medizinischer Wissenschaft und Chirurgie und Physiotherapie, in der Behandlung des Alkoholismus und in der psychiatrischen Versorgung waren das Ergebnis.
Insbesondere die Geschichte der modernen Traumatherapie wäre ohne die Folgen der beiden Weltkriege und – wie Patrick Hagopians Beitrag dokumentiert – des Vietnamkrieges undenkbar.
Zu einer verbesserten Reintegration trugen freilich nicht nur medizinische Fortschritte bei, die das Los der physisch und psychisch beeinträchtigten Veteranen spürbar erleichterten. Sie profitierten darüber hinaus von den ihnen offerierten Bildungschancen, nicht zuletzt vom Zugang zum höheren Bildungswesen. Mit öffentlicher Unterstützung boten Colleges und Universitäten nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg im ganzen Land kostenlose Studienprogramme oder Stipendien für Veteranen an – so etwa die University of Virginia und mehrere Hochschulen in Georgia, Illinois und Neuengland. Diese Beseitigung von Bildungs- und Qualifizierungsbarrieren nahm bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlich umfangreichere Maßnahmen vorweg, die im 20. Jahrhundert etwa in Gestalt des paradigmatischen Servicemen Readjustment Act aus dem Jahr 1944 ergriffen wurden, die sogenannte GI Bill. Neben Arbeitslosenhilfen, Krankenversicherung und Kreditgarantien für den Kauf von Häusern, Farmen und Kleinbetrieben gewährte die GI Bill die Finanzierung einer je nach absolvierter Dienstzeit bis zu vier Jahre dauernden College- oder Berufsausbildung, deckte also die Kosten eines Bachelor- oder Facharbeiterabschlusses ab. Das Bildungspaket der GI Bill umfasste mit jährlichen Kosten von bis zu 8 Milliarden Dollar ein Viertel des US-Bundeshaushaltes. Diese staatliche Qualifizierungsoffensive erwies sich somit kostspieliger als der Marshallplan. Rund die Hälfte aller Anspruchsberechtigten, 7,8 Millionen Veteranen, machte von der Offerte Gebrauch. Die GI Bill veränderte nicht nur das Bildungssystem, sondern auch die Berufsstruktur und soziale Schichtung des gesamten Landes gravierend. In der Zeit nach 1944 entstanden nicht nur 5 600 neue Bildungsinstitutionen, sondern auch die großen Massenuniversitäten der USA, Forschung. Bahnbrechende Neuentwicklungen in der Prothetik, plastischen mit Studentenzahlen im jeweils fünfstelligen Bereich. 49 Prozent aller Studierenden des Jahres 1947 waren Veteranen. Gerade die technischen und medizinischen Berufe erlebten eine Blüte. Die Zahl der Ingenieure in den USA verdoppelte sich auf eine halbe Million, mehr als drei Millionen geförderte Facharbeiterausbildungen produzierten Hunderttausende neuer Automechaniker, Elektrotechniker und Installateure. Die USA verwandelten sich in eine Wirtschaftsnation der angewandten technischen Wissenschaften, deren Mittelschicht schneller wuchs als jemals zuvor. Folgerichtig bezeichnet der US-Historiker Michael Gambone die GI Bill als “the greatest social welfare program in US history”.
Zivilgesellschaft und Demokratisierung
Anspruchsvolle Programme wie die GI Bill belegen, dass Veteranenpolitik eine ganze Gesellschaft zu stabilisieren und zu befrieden vermag. Doch auch als Austragungsfeld politischer wie sozialer Konflikte liegen in ihr Chancen zur Einübung demokratischer Spielregeln und damit zum Aufbau einer vitalen Zivilgesellschaft. So liefert die internationale Forschung zu Veteranenorganisationen bestechende Evidenzen dafür, dass eine Fokussierung auf das politische Trauma der Weimarer Republik – Veteranenverbände als Steigbügelhalter der Diktatur – analytisch zu kurz greift. Gerade die US-amerikanische Erfahrung des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt, dass Veteranenverbände wie etwa die 1866 gegründete Grand Army of the Republic (GAR) und ihre Vorgängerorganisationen meisterhaft auf der Klaviatur demokratischer Parteienpolitik zu spielen wussten. Sie waren außerordentlich erfolgreiche Lobbyisten, begründeten moderne Formen des Wahlkampfes und zwangen Republikaner wie Demokraten immer wieder dazu, in ihren politischen Programmen Farbe zu bekennen. Wie Stephen Ortiz in seinem Beitrag ausführt, stellten der Bonus March von 1932 und die vom Washingtoner Establishment als bedrohlich empfundenen Veteranenproteste der 1930er-Jahre Formen des politischen Widerstands dar, der am demokratischen Konfliktaustrag partizipierte. Sowohl die konkurrierenden Organisationen der American Legion und der Veterans of Foreign Wars als auch deren Bündnisse mit anderen New-Deal-Dissidenten waren Akteure innerhalb eines zivilgesellschaftlichen Wettbewerbs, der die politische Willensbildung an die Einhegung öffentlich verhandelter Interessenkonflikte band.
Selbst die vermeintlich so eindeutige europäische Erfahrung mit Veteranenverbänden in der Zwischenkriegszeit lässt sich nicht auf die Eskalation paramilitärischer Gewalt reduzieren, die im Endeffekt zum Erstarken der antidemokratischen Kräfte beigetragen hat. In Deutschland bildeten sich mit dem Reichsbanner und dem Reichsbund Organisationen mit über 1,7 Millionen Mitgliedern, die für sozialdemokratische Ideale kämpften. In Gestalt der Inter-Allied Federation of Former Combatants (FIDAC) und der International Conference of War Victims and Former Combatants (CIAMAC) formierten sich nach dem Ersten Weltkrieg transnationale Veteranenverbände, die sich gemeinsam mit der International Labour Organisation (ILO) für Pazifismus, internationale Kooperation und eine bessere Sozialpolitik in Europa einsetzten. Die meisten Staaten zogen zudem Lehren aus den fatalen Fehlern der Zwischenkriegszeit. Karsten Wilkes Beitrag zeigt unter anderem, wie geschickt die Veteranenverbände in der jungen Bundesrepublik kooptiert, das heißt, in demokratische beziehungsweise rechtsstaatliche Verfahrensregelungen eingebunden wurden. Als gut organisierte Interessengruppe konnten sie Einfluss auf die Gestaltung des Bundesversorgungsgesetzes von 1950 nehmen, sie waren insofern also tatsächlich Protagonist eines “corporate, consensual decision-making process”. Dank des Grundgesetzes, das im Artikel 131 ehemaligen Wehrmachtsoffizieren Pensionsansprüche gewährte, profitierten die Veteranen und ihre potenziell gefährlichen Meinungsführer vom neu verfassten politischen Gemeinwesen. Aus prospektiven troublemakers wurden stakeholders des demokratischen Systems, die ihre ureigenen Interessen repräsentiert fanden.
Die politische Auseinandersetzung um Fragen der Reintegration konnte also nicht nur die Vorzüge demokratischer Partizipation vor Augen führen, sie erleichterte zudem die Überwindung innergesellschaftlicher Spannungen und das enfranchisement benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weil die Leistungen der Veteranen in öffentlichen Anerkennungsritualen zu erinnern waren und die kollektive Dankbarkeit für ihren Einsatz zum Ausdruck gebracht werden musste, empfahlen sie sich als integrierender Faktor bei der Ausformulierung nationaler Narrative. Schon Napoleons Regime übte dementsprechend ein nationales Erzählmuster ein, das mit der Bezugnahme auf die Veteranen des ancien regime, der Revolutionskriege und der eigenen Feldzüge, also über die faktischen Zäsuren der Revolutionsgeschichte hinweg, ein Gefühl politischer Zusammengehörigkeit und geschichtlicher Kontinuität zu schaffen beabsichtigte. (Da nationale master narratives bekanntlich immer auch mit Exklusionen operieren, macht Alan Forrests Beitrag in dieser Ausgabe zu Recht auf die Veteranen aufmerksam, die ausgeschlossen wurden.) Doch treten Veteranen nicht nur als Objekte nationaler Erzählungen in Erscheinung, vielmehr haben sie sich auch als Akteure nationaler Geschichtspolitik zur Geltung gebracht. So bemühten sich Veteranenkomitees nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges um einen Lehrplan für den Geschichtsunterricht an Schulen, der zur Versöhnung der Konfliktparteien beitragen sollte. Im Übrigen inszenierten sie gemeinsame Schauspiele und reenactments auf den einstigen Schlachtfeldern. Das politische wie militärische Engagement konföderierter Veteranen setzte in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg ein deutlich sichtbares Zeichen für das erneute Zusammenwachsen der Nation.
Sowohl ethnischen Minderheiten wie auch den Frauen erschlossen die Anerkennung ihrer Versorgungsansprüche und die Bereitschaft, ihre Verdienste um das Vaterland öffentlich zu würdigen, in den unruhigen, aber auch formbaren Zeiten nach großen Kriegen ganz eigene Chancen, sich überkommenen gesellschaftlichen Rollenzuweisungen zu widersetzen. Auch wenn Kritiker der Reintegrationspolitik zu Recht angemerkt haben, dass es in der Geschichte der Vereinigten Staaten – beispielsweise bei der Bearbeitung von Anträgen auf Bürgerkriegsrenten oder Förderungsmaßnahmen unter der GI Bill – zu massiven Diskriminierungen von Afroamerikanern, Hispanics, Irischstämmigen oder anderen Minderheiten gekommen ist, bleibt ein entscheidender Punkt von solchen Bedenken doch unberührt: Rechtlich waren alle Veteranen gleichgestellt. Sie hatten prinzipiell gleichwertige Ansprüche, weshalb der Veteranenstatus – gerade aus zeitgenössischer Sicht – als ein nicht zu unterschätzender Katalysator staatsbürgerlicher Egalisierung wirkte. Wie verschiedene Historiker hervorgehoben haben, gab die rechtliche Kodifizierung ihres Status etwa den afroamerikanischen Veteranen der USA ein willkommenes Instrument an die Hand, auf das sie in ihrem Kampf um mehr Gleichberechtigung lange gewartet hatten.
Ähnliches gilt für die weiblichen Veteraninnen und ihr Engagement in Organisationen wie dem Women’s Army Corps (WAC) oder bei den Women Airforce Service Pilots (WASP). Mit einigem Erfolg setzen benachteiligte Gruppen in ihrem Verlangen nach Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Anerkennung auf ihren Veteranenstatus als den “gold standard of citizenship”.
Ausblick: Der Preis der Reintegration
Natürlich gehen historische Perspektivierungen selektiv vor. Sie konzentrieren sich bewusst auf gewisse Ausschnitte des geschichtlichen Geschehens. In der Reintegration primär einen Motor der Ausdifferenzierung von Staatlichkeit und bedeutsamer gesellschaftlicher Innovationen zu erkennen, heißt deshalb zwangsläufig, andere Facetten derjenigen Geschichte, in der es um die Vielzahl von Maßnahmen geht, die Gesellschaften ergriffen haben, um vormalige Krieger und Kämpfer sozial wieder einzugliedern, abzuschatten und zu verschweigen. Dass sich der Einzelfall gewöhnlich komplizierter und weniger eindeutig darstellt, als es die übergreifende historiografische Rahmung dieses Heftes vielleicht nahelegt, veranschaulichen die nachfolgenden Beiträge. Sie machen deutlich, dass selbst dort, wo Prozessen der Reintegration ein innovativer und den gesellschaftlichen Fortschritt beflügelnder Charakter zugeschrieben werden kann, doch stets auch leidvolle Erfahrungen gemacht wurden, ja hohe und schmerzhafte Preise zu zahlen waren.
In seiner Studie zu den Veteranen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege enthüllt Alan Forrest ein grundsätzliches Problem, mit dem sich jede Geschichte von Reintegrationen mehr oder weniger konfrontiert sieht. Die Ansprüche der Veteranen auf materielle Kompensationen und offizielle Anerkennung ihrer Opferbereitschaft stoßen gewöhnlich auf politische Kalküle, die praktizierte Loyalitäten nachträglich belohnen, gegebenenfalls aber auch bestrafen, das heißt Illoyalität ächten wollen. So sah Napoleon, wie bereits angedeutet, die Einheit der Nation und das Kontinuum französischer Geschichte in den Veteranen symbolisch verkörpert, was jedoch nach der Restauration der Monarchie zwangsläufig die Ausgrenzung derjenigen Veteranen nach sich zog, die auf der “falschen” Seite gekämpft hatten. Ihnen wurde der Zutritt zum nationalen Gedächtnis verwehrt.
Stephen Ortiz zeichnet in seinem Aufsatz den schmalen Grat zwischen demokratischem Protest und demokratiefeindlicher Radikalisierung nach, auf dem sich die politische Mobilisierung derjenigen US-amerikanischen Veteranen bewegte, die ihren Anliegen in der Zwischenkriegszeit Gehör verschaffen wollten. Letztlich habe, so Ortiz, dieses Engagement die Demokratie der Vereinigten Staaten gestärkt, doch sei zugleich unübersehbar, dass es beträchtliche Verunsicherungen und tiefsitzende Ängste geschürt habe. Die Furcht der Zeitgenossen vor einer heraufziehenden “Veteranendiktatur ” in den 1930er-Jahren, die vielgesichtig in dystopischen Romanen wie der Tagespresse zum Ausdruck kam, sich aber auch in der Härte polizeilicher Überreaktionen auf Protestversammlungen der Veteranen niederschlug, ist, zumal im vergleichenden Seitenblick auf die Verfallsgeschichte der Weimarer Republik, offensichtlich nicht unbegründet gewesen.
Dass Reintegration auch dann ihren Tribut fordert, wenn sie erfolgreich und ohne Zwischenfälle verläuft, illustriert Karsten Wilke. Durch Versorgungsleistungen und Mitwirkungsangebote versicherte sich die junge Bundesrepublik der Kooperation von Veteranen der Wehrmacht und Waffen-SS. Damit konnte eine prospektive Gefahr, die von diesen Bevölkerungskreisen ausging, wirksam gebannt werden. Allerdings ließ sich das zarte Pflänzlein der Demokratie offenbar nur schützen, indem man ihnen in den 1950er-Jahren nicht allzu viele bohrende Fragen stellte – und stattdessen lieber in die Rententöpfe einzahlte.
Auch die in diesem Vorwort betonten Innovationen, was Entwicklungen im Bereich der politischen Kultur und Wissenschaft anlangt, fügen sich nicht in ein bruchloses Bild. Nehmen wir nur ein Beispiel aus Patrick Hagopians Aufsatz. Er zeigt, dass die Auseinandersetzungen um die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen anfänglich untrennbar mit dem politischen, nicht zuletzt pazifistisch motivierten Protest gegen den Krieg in Vietnam verbunden waren. Nachdem die “Post-Traumatic Stress Disorder” zu einer wissenschaftlich akkreditierten Krankheit in offiziellen Diagnosemanualen aufgestiegen war, büßte der Streit um das Syndrom seine Explosivität ein und fand sich in eine politisch gänzlich entschärfte Ideologie der “nationalen Heilung” überführt.
Die Tiefenschärfe und Feinkörnigkeit der verschiedenen Fallanalysen mögen die argumentative Grundlinie dieses Themenheftes im Einzelnen relativieren. Sicherlich wäre es verfrüht, die historiografische Beschäftigung mit Reintegrationsprozessen als ein Forschungsprogramm auszurufen, das die Kompetenzen der Gesellschaftsgeschichte revitalisiert. Doch ist wohl kaum zu bestreiten, dass sich die Frage nach der Wiedereingliederung von Veteranen als fruchtbar erweist, um die Innovationsmöglichkeiten von Gesellschaften zu sondieren, die Nachkriegszeiten durchleben.