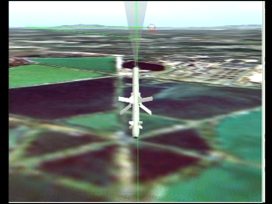Unzählige sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass der Industriekapitalismus etwa alle 40 Jahre von einer massiven Krise erschüttert wird, in der die Strukturelemente der gesellschaftlichen Ordnung einen langsamen, aber fundamentalen Wandel durchlaufen. Die 1930er-Jahre waren von einer solchen Krise gekennzeichnet, ebenso die 1970er. Und heute erleben wir erneut eine massive Kapitalismuskrise.1 Über die derzeitige Lage ließe sich so einiges sagen, dennoch möchte ich mich hier auf eine Krisenerfahrung konzentrieren, die ich als Ästhetik der Krise bezeichne. Zu diesem Zweck werde ich ein paar sehr subjektive Fragen stellen. Wie fühlt sich die Krise an? Wie verändert sie die eigene Orientierung und das Selbstempfinden? Welche Affekte erzeugt sie, und wie verbreiten sich diese unter den Menschen? In welcher Form wird die Krise zum Ausdruck gebracht, wie wird sie vermittelt? Welche kulturellen Konsequenzen haben diese Ausdrucksformen? Auf all diese Fragen gibt es weder richtige noch falsche Antworten. Vielmehr handelt es sich um ethische Fragen. Sie fordern uns alle auf, die Bedeutung unserer persönlichen Erfahrungen zu hinterfragen, die von Land zu Land, von Schicht zu Schicht und von Mensch zu Mensch äußerst unterschiedlich sind.

Photo: lcrf. Source: Flickr
Über Ästhetik zu reden, heißt, über Kunst zu reden. Das, wonach ich suche, lässt sich aber nicht auf das Kunstobjekt reduzieren. Ich beziehe mich vielmehr auf etwas, das Raymond Williams als “structures of feeling”, als Gefühls- oder Empfindungsstrukturen bezeichnet hat.
Mit diesem Begriff benannte Williams ein in Entstehung befindliches Set an Einstellungen, Vorlieben und Abneigungen, Schwärmereien und Bedenken, Einsichten und Grundblindheiten, das es Menschen ermöglicht, einander als an der Schaffung einer gemeinsamen Gegenwart Beteiligte zu erkennen, als auf dem Höhepunkt von etwas, das nur sie ganz begreifen und realisieren können. Williams bezieht sich dabei auf charakteristische Elemente wie Impuls, Zurückhaltung, Ton; auf ausdrücklich affektive Elemente wie Bewusstsein und Beziehung; darauf, dass Fühlen nicht der Gegensatz von Denken ist, sondern dass Gedanken gefühlt und Gefühle gedacht werden; kurzum: ein gegenwärtiges praktisches Bewusstsein in einer lebendigen und Zusammenhänge schaffenden Kontinuität. Oder wie es im Original heißt: “We are talking about characteristic elements of impulse, restraint, and tone; specifically affective elements of consciousness and relationships: not feeling against thought, but thought as felt and feeling as thought: practical consciousness of a present kind, in a living and inter-relating continuity.”2
Das, worüber William hier spricht, ist so subtil und unbestimmt, dass allein schon der Verweis darauf eines Kunstwerks bedarf. Nur so lassen sich Formen heraufbeschwören, die konkret genug sind, um sich überhaupt in Worte fassen zu lassen. Die Ästhetik der Krise handelt daher von den Formen, mittels derer ein in Entstehung begriffener gesellschaftlicher Veränderungsprozess wahrnehmbar und spürbar wird. Durch die Verknüpfung einer bestimmten Atmosphäre mit einer Auswahl von Bildern, einer Folge von Rhythmen, einer Reihe von Situationen, Annahmen, Konflikten und Hoffnungen kann ein Kunstwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einer bestimmten Gruppe von Menschen oder einer bestimmten Generation eine beginnende Empfindungsstruktur hervorrufen.
Wir alle kennen dieses Gefühl: Man steht vor einem Kunstwerk oder einer Performance, die genau das auszudrücken scheint, was einem selbst auf der Zunge liegt, und man spürt sogleich ihr Potenzial. In den Gezi-Park-Protesten in der Türkei entstand unlängst eine solche “Empfindungsstruktur”, inszeniert von dem Performancekünstler Erdem Gündüz, der daraufhin als “stehender Mann” bekannt wurde.
Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste stand er einfach da, auf einem öffentlichen Platz, still, arretiert, unbeweglich. Das in dieser Geste enthaltene Potenzial des Widerstands war für alle deutlich spürbar. Alsbald wurde seine Performance von Tausenden von Menschen übernommen und abgewandelt. Sie standen im öffentlichen Raum still und lasen, zum Beispiel Kafka, unter den Blicken der Polizei.
Wir reden also über Ästhetik im Sinne einer Empfindungsstruktur für eine Gruppe und speziell eine Generation. Allerdings mit einer kleinen Besonderheit: Mir geht es um die Momente, in denen Empfindungsstrukturen zusammenbrechen und wir nicht ihre Anwesenheit, sondern ihre Abwesenheit spüren, ihr Nichtvorhandensein, ihre Vergeblichkeit. Damit nicht genug, möchte ich zeigen, dass der Zusammenbruch selbst eine Struktur aufweist. Diese gebrochene Struktur muss sich irgendwie aus der Fehlfunktion bzw. dem Versagen des gesellschaftsübergreifendsten aller Gesetze ergeben. Im Fall von kapitalistischen Demokratien ist dies das Gesetz der Ökonomie.
Es mag seltsam klingen, aber auch in anderen Generationen haben Menschen über exakt die gleichen Fragen nachgedacht. So auch der amerikanische Marxist James O’Connor, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Er erlebte die Krise des Wohlfahrtsstaats in den 1970er-Jahren und wertete sie als Legitimierungskrise.3 Im Anschluss untersuchte er einige der dauerhaften Folgen dieser Krise. Seine wichtigste Erkenntnis war, dass der Kapitalismus – ein auf der Produktion, dem Verkauf und dem Konsum von Waren basierendes System – seine Subjekte tendenziell dazu bringt, sich selbst als Dinge, als besitzbares Objekt zu betrachten.
O’Connors Schlussfolgerung lautete in etwa so: Wenn die gewöhnliche Ware ein glänzendes, teures, funkelndes Etwas ist, dessen Besitz seinen BesitzerInnen in den Augen anderer Prestige und gesellschaftliche Macht verleiht, warum sollte man dann die eigene Identität nicht ebenso sachlich bewerten? Warum sollte man nicht in sie investieren, sie verbessern, sie hegen und pflegen und zur Schau stellen wie einen wertvollen Besitz? Warum sollten wir von einer guten Identität nicht das gleiche Prestige und die gleiche Macht erhoffen, die wir uns erwarten, wenn wir in einem glänzenden BMW-Sportwagen bei einem Freund vorfahren? Kurz gesagt, warum sollten wir uns nicht selbst verdinglichen? Warum uns nicht selbst wie einen Gegenstand behandeln? In dem Fall wäre das Individuum ständig von der heimlichen Angst getrieben, dass diese Verdinglichung womöglich nicht gut genug sein könnte. Das Individuum würde andauernd versuchen, seinen Selbstwert unter Beweis zu stellen, das Prestige des Selbst auszuloten, um so die Beschränkungen dieses glänzenden, aber irgendwie auch angeschlagenen Dings zu überwinden. Die Krise ereilt das Individuum in dem Moment, in dem das Ziel der perfekten Selbstverdinglichung eindeutig nicht mehr erfüllt werden kann.
O’Connor musste diese Vorstellungen vom verdinglichten Selbst nicht erfinden; in der amerikanischen Gesellschaft existierten sie bereits, und zwar kodifiziert in den Doktrinen der Werbeindustrie. Die Institution der Werbung hatte die Rolle des Besitzes bei der Etablierung der Statushierarchie analysiert und brachte den Leuten nun eifrig bei, wie sie sich selbst durch den Kauf von Accessoires aufwerten konnten (so die Botschaft des berühmten Buchs von Ernst Dichter, The Strategy of Desire – Strategie im Reich der Wünsche). O’Connor hat das Scheitern der Selbstkommodifizierung während einer Krise nachgezeichnet, dem Moment, in dem der Preis der eigenen Vermögenswerte plötzlich fällt und die Wirtschaft, die einen bestimmten Geldwert garantierte, plötzlich einfriert. In solchen Momenten verliert dein “Ding”, sprich du selbst, plötzlich ihren Glanz und erscheint zunehmend dumpf, hässlich, welk oder gar wertlos, grotesk und erbärmlich. Zu beobachten war dieses Phänomen vor gar nicht allzu langer Zeit in der amerikanischen Gesellschaft, und zwar kurz vor und während der Occupy-Bewegung: Tausende und Abertausende von Arbeitslosen waren damals mit einer Krise des persönlichen Selbstwerts konfrontiert. Gleichzeitig besteht so immerhin die Gelegenheit zu einer kritischen Reflexion und Werteverschiebung bzw. -neudefinition, was wiederum ein Verständnis für und Interesse an interdependenten, wechselseitigen Beziehungen fördert, die Menschen, die vom Markt im Stich gelassen wurden, als Stütze dienen können. Das ist genau der Moment, in dem eine neue Empfindungsstruktur entstehen kann. O’Connor hat diesen Vorgang vor rund 30 Jahren sehr treffend formuliert:
“Der Wahnsinn der Akkumulation, die Angst, dass sie in einem riesigen Crash oder einer Umwelt- oder Militärkatastrophe enden wird, die unglaublichen Exzesse des Spätkapitalismus auf der ganzen Welt – all das beweist die Zwanghaftigkeit der inneren ‘Seele’ des Kapitals. Wenn wir zu seinem inneren Auge werden könnten, wenn wir in sein Innerstes vordringen könnten, wenn wir das unaufhörliche Pulsieren der Akkumulation hören könnten, dann könnten wir den Wahnsinn dieser Besessenheit sowohl erleben als auch erkennen –, jener Welt, in der Kapital und Geld eine religiöse und ästhetische Erfahrung darstellen und Macht eine moralische Kategorie. Wenn wir in uns gehen, finden wir das Kapital auch in unseren Seelen. Auch wir hasten durch die Gegenwart, rennen irgendeinem Sieg hinterher – oder auf irgendein unbekanntes Ziel zu; gesteuert von einem unbändigen Verlangen stolpern und fallen wir aus unserer Identität in einen Abgrund. Wir schaffen uns unsere eigene persönliche Krise, wie auch das Kapital seine eigene Krise schafft.”4
Das Faszinierende an diesem Text ist die parallele Bewegung von Selbst und Gesellschaft. Beim Lesen bekommen wir ein Gespür dafür, wie die menschliche Persönlichkeit sich im Wachstum des Kapitals spiegeln kann, wonach abstrakte wirtschaftliche Funktionen – Automation, Transnationalisierung, Finanzialisierung – allesamt ein inneres Imperium reflektieren, das zu einem letztendlich selbstmörderischen Prozess der Expansion und Eroberung verdammt ist. O’Connor suggeriert, dass der Schlüssel zu unserem ganz persönlichen Schicksal in der Erforschung, nicht etwa unserer eigenen Psychologie, sondern ebendieser abstrakten Funktionen liege. Dies ist die Grundlage der Heteronomie: die Erkenntnis, dass wir fremdbestimmt sind, dass eine andere Norm, ein anderes Gesetz uns kontrolliert. Wir sind entfremdet: Wir sind nicht einmal mehr Herr unserer eigenen Persönlichkeit. Mit dieser Erkenntnis tut sich eine sehr vieldeutige Möglichkeit auf, nämlich die Vorstellung, dass wir ebenso wie das Kapital unsere eigene Krise schaffen könnten. Vieldeutig heißt, dass sich mindestens zwei Wege anbieten. Entweder wiederholen bzw. ahmen wir die Krise des Kapitals nach oder wir nutzen den Augenblick, um auf unserem persönlichen Weg eine Abzweigung zu nehmen. Diese Ambiguität der selbst geschaffenen Krise ist das Dilemma des Individuums in der kapitalistischen Gesellschaft.
Selbstgesetz
Birgt eine Krise, die man nicht bloß erleidet, sondern selbst mitgeschaffen hat, das Potenzial für Selbstveränderung und vor allem auch für gesellschaftliche Veränderung? Könnte aus der desaströsen Blockade der Gegenwart eine neue und vielversprechende Empfindungsstruktur erwachsen? Ich halte dies für möglich. Um sicherzugehen, müsste man sich allerdings an diese Möglichkeit herantasten, ihr bei ihrem Wirken im Selbst und in der Gesellschaft konkret begegnen können. Man müsste an ästhetischen Erfahrungen teilhaben, die beim Zusammenbruch der dominanten Wirtschaftsnormen den Weg für irgendeine Art von Autonomie eröffnen: einen Weg zum Selbst, dem autós, das sein eigenes Gesetz schafft, sein nómos. Um den Wert des eigenen Lebens inmitten der Krise anders zu verorten oder neu zu erfinden, müsste man sich an der Schaffung eines neuen Territoriums, einer neuen Norm und eines neuen Gesetzes beteiligen. Denn diese drei Dinge – Territorium, Norm, Gesetz – sind als Grundideen in dem griechischen Begriff nómos enthalten. Wie kann ein Kollektiv autonom werden? Wie können wir einen Status der Selbstregierung erreichen? Und wie können wir es vermeiden, uns vom Scheinbild der Selbstregierung betrügen zu lassen – denn genau das erleben wir derzeit in den kapitalistischen Demokratien?
Ich möchte versuchen, diese Fragen anhand der Ideen des vergessenen Philosophen Cornelius Castoriadis zu beantworten. Er war eine zentrale Figur des Mai 1968. Heute machen sich nur noch wenige die Mühe, ihn zu lesen. Vielleicht, weil er uneindeutige Sachverhalte nicht eindeutiger gemacht hat. Castoriadis versucht zu verstehen, wie Individuen einen Einfluss auf eine Gesellschaft haben können, die sie [die Individuen] geschaffen hat. Er versucht zu verstehen, wie das radikale oder instituierende Imaginäre aus dem bestehenden Normensystem bzw. aus dem von ihm als “imaginäre Institution der Gesellschaft” bezeichneten Konstrukt ausbrechen kann. Er erkennt, dass es im Leben des Menschen nicht nur um Ideen oder Repräsentationen geht. Es geht auch um Affekte, um Gefühle und um die Handlungsabsichten oder -potenziale, die von Affekten ausgelöst werden. Er verortet das Sein innerhalb eines soziohistorischen Magmas aus übernommenen Ideen, Affekten und Intentionen und merkt dazu an, dass die Mindestanforderung an den Fortbestand einer Gesellschaft darin besteht, dass die individuelle Psyche in der Lage sein sollte, in dem herausragenden Teil dieses unermesslichen soziohistorischen Magmas, dessen Oberfläche die Gegenwartskultur ist, einen Sinn zu erkennen. Hier ist die Ästhetik der Krise zum Greifen nah. Zu welcher Art von Zusammenbruch oder Revolte wird es wohl kommen, wenn wir angesichts der Oberflächenbeschaffenheit unseres gegenwärtigen historischen Moments die grundlegendsten Vorstellungen unserer Gesellschaft nicht erfüllen können? Wie kommt es zu solch einem Zusammenbruch oder besser zu solch einer Revolte?
Castoriadis sagt Folgendes: “Nur insofern es der radikalen Imagination der Psyche gelingt, durch die sich überlagernden Schichten des gesellschaftlichen Panzers zu sickern, den das Individuum trägt und mit dem es bis zu einem unauslotbaren Grenzpunkt verwächst, gibt es noch eine Rückwirkung des Einzelnen auf die Gesellschaft.”5 Durchsickern durch einen Panzer: Dies sind die Begrifflichkeiten eines persönlichen Konflikts zwischen dem psychischen und dem sozialen Imaginären. In Anbetracht der Panzerung der heutigen Gesellschaft klingt dies nach einem ungleichen Kampf. Was, wenn die Revolte nur durch ein paar wenige Deiche sickert oder in Kanäle oder Becken oder Flüsse, die schon darauf vorbereitet waren, sie aufzunehmen? Was, wenn die Institution der Gesellschaft die Formen der Revolte, die gegen sie entstehen könnte, bereits imaginiert hat? Was, wenn Heteronomie, oder Entfremdung, immerfort bereit wären, die Maske der Autonomie oder der Befreiung anzulegen? All das sind für unsere Gegenwart typische Fragen, Fragen der “Gesellschaft des Spektakels”, Fragen, die Guy Debord Castoriadis gestellt haben könnte, wären sich die beiden in den frühen 1990er-Jahren wiederbegegnet. “Ist diese total mediatisierte Pseudodemokratie nicht eine große Falle, die das, was man individuelle Psyche nennt, gefangen hält und definiert?”, hätte Debord gefragt. Castoriadis würde aus größerer historischer Distanz antworten und dabei auf den Fundus der demokratischen Revolution verweisen:
“Es sei vorweggenommen, dass eine solche Rückwirkung sehr selten vorkommt, in Gesellschaften, in denen instituierte Heteronomie herrscht, d.h. in nahezu allen Gesellschaften, jedenfalls nicht wahrnehmbar ist. In diesen gibt es über das Spektrum vorgegebener gesellschaftlicher Rollen hinaus nur zwei Möglichkeiten für die individuelle Psyche, sich in erkennbarer Form zu äußern: Überschreitung und Wahnsinn. Anders verhält es sich in den wenigen Gesellschaften, in denen der Bruch mit der totalen Heteronomie eine wirkliche Individuierung des Individuums ermöglicht und die radikale Imagination der einzelnen Psyche zugleich die gesellschaftlichen Mittel für einen eigenständigen öffentlichen Ausdruck finden oder erzeugen oder zur Selbstveränderung der gesellschaftlichen Welt beitragen kann.”6
Beim Lesen dieses komplexen Absatzes fielen mir als Erstes die Begriffe Überschreitung und Wahnsinn auf. Genau in dieser Hinsicht werden hochabstrakte Wirtschaftsanalyse und politische Philosophie mit einem Mal ungemein persönlich. Wer wurde bei dem Versuch, sich den Normen und Gesetzen bestehender Institutionen zu entziehen, nicht der wahnsinnigen Überschreitung bezichtigt? Wie oft wurde ich selbst schon als Spinner, Verbrecher oder Krimineller bezeichnet? Dabei ist doch klar, dass ich lediglich versuche, in meinem Leben ein Ideal zu erfüllen, das seinen Ursprung in der Geschichte und der Gesellschaft hat, die mich geschaffen haben. Zweifelsohne, liebe LeserInnen, versuche ich wie Sie, einen Sinn in der demokratischen Gesellschaft zu sehen. Nur welchen Sinn kann ich unter den gegenwärtigen Bedingungen erkennen? Welchen Sinn können Sie unter den gegenwärtigen Bedingungen sehen?
Während ich über all diese Dinge nachdachte, kam es zu den Ereignissen in Frankreich, dem Charlie-Hebdo-Massaker und dem anschließenden Mord an vier JüdInnen in einem Supermarkt. Die brutalen und chaotischen Kriege, die den Mittleren und Nahen Osten seit über einem Jahrzehnt erschüttern, entluden sich gewaltsam in Paris (seit vielen Jahrzehnten meine zweite Heimat). Ein paar Tage später strömten Millionen von Menschen auf die Straßen und trugen Schilder mit der Aufschrift “JE SUIS CHARLIE”. Hier sahen wir die Verbindung aus einem zutiefst persönlichen und einem zutiefst sozialen Akt, der nicht nur eine Reaktion auf die Bedrohung der persönlichen Sicherheit war, sondern auch auf die Bedrohung der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks. Hat dieser Moment es “der radikalen Imagination der einzelnen Psyche” erlaubt, “die gesellschaftlichen Mittel für einen eigenständigen öffentlichen Ausdruck [zu] finden oder [zu] erzeugen oder zur Selbstveränderung der gesellschaftlichen Welt” beizutragen? War dies in der Tat ein Moment, in dem “Gesellschaft und Individuen sich gemeinsam verändern”, was für Castoriadis das Kennzeichen einer demokratischen Revolution ist? Kurz gesagt, war dies ein Aufwallen der Selbstregierung?
Während der französische Premierminister Manuel Valls begann, eine Reihe von Statements abzugeben, deren Höhepunkt die Erklärung eines französischen Kriegs gegen den Terror war, begann ich, mir die Geschichte von Charlie Hebdo genauer anzusehen. Die aus den 1960er-Jahren stammende Satirezeitschrift hieß ursprünglich Hara-kiri und wurde 1970 verboten, weil sie sich über Charles de Gaulle im Augenblick seines Todes lustig gemacht hatte. Diese CartoonistInnen sind transgressive 1968er-HeldInnen. Die Zeitschrift tut nichts anderes, als ihre konkrete politische Ansicht zu aktuellen Entwicklungen mit einer provokativen affektiven Analyse zu verknüpfen. Schockiere die Leute, gegen die du bist, um denen eine Freude zu machen, für die du bist: Das ist im Wesentlichen die Formel. Ich las die Statements von Luz, einem der überlebenden Cartoonisten. Er behauptet, Charlie Hebdo sei gegen jede Art von Symbolismus. “Friedenstauben und andere Metaphern einer Welt im Kriegszustand sind nicht unser Ding. Wir arbeiten an Details, an konkreten Aspekten in Verbindung mit dem französischen Humor und unserer Art, die Dinge à la française zu sehen.” Die Idee, dass “wir vorsichtig sein müssen, was wir in Frankreich tun, weil jemand in Kuala Lumpur oder sonstwo darauf reagieren könnte”, weist er zurück und sagt: “Wenn Leute unsere Cartoons im Internet posten, wenn die Medien einige unserer Cartoons besonders hervorheben, so ist das deren Verantwortung, nicht unsere.”7
Trotz meiner Sympathie für diesen Mann, der gerade in einem schrecklichen, durch nichts zu rechtfertigenden Massaker ein Dutzend enger KollegInnen verloren hat, hat mich diese Erklärung überrascht. Medienarbeit ist eine persönliche, verantwortungslose Aktivität? Karikaturen des Propheten Mohammed sind nicht symbolisch? Frankreich, das seine Armee und Ölkonzerne in alle möglichen Länder schickt, ist eine hermetisch abgeriegelte Enklave, wo der spezielle Humor à la française herrscht? War das die öffentliche Bedeutung – die Empfindungsstruktur – von “JE SUIS CHARLIE”?
Ich teile die Entrüstung von Millionen von Menschen über die brutalen Morde, die im Namen der Religion innerhalb der Grenzen eines Landes begangen wurden, das sich stets als säkular verstanden hat. Ich glaube auch, dass die massive Solidaritätsbekundung für die Opfer von Gewalt etwas sehr Positives sein kann – nämlich in der Tat ein öffentlicher Ausdruck von Demokratie. Nichtsdestotrotz war die prinzipielle Aussage dieser Demonstration eine narzisstische, eine, die das Selbst mit transgressiver Verantwortungslosigkeit gleichsetzt und diese trangressive Gleichsetzung in eine nationale Geste verwandelt. Kurz gesagt war dies die perverse Erfüllung des 1968er-Slogans “l’imagination au pouvoir” (Fantasie an die Macht). Nun ist dies gewiss nicht die Botschaft, die alle TeilnehmerInnen der Demonstrationen vermitteln wollten, und ich bin sicher, dass viele Menschen immer noch damit beschäftigt sind, dem Slogan “JE SUIS CHARLIE” andere Bedeutungen zu geben. Dennoch haben wir es mit einem symbolischen Paradoxon zu tun, und in der Tat auch mit einer symbolischen Fallgrube – da hat Luz absolut recht –, wenn die persönliche Identifikation mit überschreitender politischer Satire zu einem Schlachtruf für den europäischen Rassismus und den “Kampf der Kulturen” wird. Am Beispiel der Vereinigten Staaten haben wir bereits die Militarisierung der Demokratie unter dem Deckmantel des nationalen Patriotismus und dem Schutz der Freiheit gesehen. Die Psyche und die Gesellschaft mögen sich gemeinsam verändern, wie Castoriadis es postuliert hat, aber nicht auf eine Art, die die Grenzen der Demokratie erweitern würde.
Angesichts des massiven Versagens der Öffentlichkeit, auf die unerbittliche Ausbreitung der gegenwärtigen politischen und ökonomischen Krise zu reagieren, werden diejenigen unter uns, die nach einem verloren gegangenen demokratischen Sinn suchen, auf die eigenen ästhetischen und für jede Nationalität, Klassenzugehörigkeit, ja für jedes Individuum komplett unterschiedlichen Erfahrungen zurückgeworfen. Im Angesicht der Krise des Kapitals müssen wir uns also unsere eigene schaffen.
Abwesende Gerechtigkeit
Am 16. Dezember 2014 nahm ich in Chicago an einem acht Kilometer langen Marsch teil, der vom Polizeihauptquartier zum Rathaus ging. Demonstriert wurde für Entschädigungszahlungen an die vornehmlich afroamerikanischen Opfer von Polizeifolter. Zwischen 1972 und 1992 hatten der Vietnamkriegsveteran Jon Burge und andere Polizeibeamte etwa 100 Männer unter Folter zu falschen Geständnissen gezwungen. Burge wurde schließlich gefeuert und zu vier Jahren Haft verurteilt, aus der er gerade entlassen wurde. Unterdessen sitzen die unschuldigen Männer, die er und seine Kollegen gefoltert haben, immer noch im Gefängnis. Das Wissen um diese Dinge nimmt einer Stadt ihren dinglichen Glanz. Es macht den Alltag unerträglich.
An der Organisation der Demonstration war auch das Kollektiv Chicago Torture Justice Memorials beteiligt, das 2012 dazu aufgerufen hatte, Vorschläge für mögliche Denkmäler einzureichen, die sich mit diesen Grausamkeiten beschäftigen.8 Die Idee der KünstlerInnen bestand darin, in einer Stadt, deren Behörden Folter praktiziert hatten, den Akt des Suchens nach der offensichtlich nicht existierenden öffentlichen Bedeutung von Gerechtigkeit sowohl visuell als auch affektiv mit möglichst vielen Menschen in einer Ausstellung zu teilen. 2012 hatten sie es geschafft, die Arbeit an der eigentlichen Ausstellungsproduktion so aufzuteilen, dass sich viele Leute intensiv daran beteiligen konnten. Jetzt wollten sie noch einen Schritt weitergehen. Sie wollten tatsächlich das Gesetz ändern. Sie wollten, dass die Stadt sich in aller Form entschuldigt, den Opfern eine Entschädigung zahlt, ihnen psychologische Beratung und kostenlose Bildungsmöglichkeiten anbietet und dass sie die Polizei auffordert, Beweise über den Einsatz von Folter zur Erzwingung von Geständnissen vorzulegen, aufgrund derer heute immer noch viele Menschen im Gefängnis sitzen – um nur die wichtigsten Forderungen zu nennen.
Bei unserem Demonstrationszug durch die Stadt feuerte eine weitere Unterstützerorganisation mit dem Namen We Charge Genocide alle anderen mit Gesängen und Schlachtrufen an. Wer mitsang, spürte die Macht des HipHops. Ein Ruf richtete sich an die massive Polizeipräsenz um uns herum. Er ging so: “Wem dient ihr? Wen beschützt ihr? Wen foltert ihr? Wir vergessen nichts!” Es gab noch einen etwas seltsamen und sehr schnellen Schlachtruf, der die Gefühle von AktivistInnen, insbesondere schwarzen, zum Ausdruck brachte, die sich von einer Gesellschaft missachtet fühlen, die ihre Äußerungen als dumm, sinnlos und gar krank bezeichnet. Alle zusammen skandierten wir: “Sie halten das für einen Witz / Sie halten das für ein Spiel / Sie halten das für einen Witz / Sie halten das für ein Spiel / Sie halten das für einen Witz / Sie halten das für ein Spiel”, und so weiter und marschierten dabei durch die noblen Straßen des Finanzviertels von Chicago.
Im Rathaus wurde die Abwesenheit von Gerechtigkeit offensichtlich: Der Bürgermeister war gerade mittagessen und konnte sich unsere Forderungen nicht anhören. Dennoch hatten die OrganisatorInnen eine Rahmenveranstaltung mit einer ausgefeilten Choreografie von Reden, Augenzeugenberichten von Opfern und deren Familien sowie Bildmaterial und Ritualen vorbereitet, an denen alle teilnehmen konnten. Im Grunde produzierten wir damit das Bild der abwesenden Justiz: Wir erzeugten eine emergente Empfindungsstruktur, und zwar auf einem Territorium, das wir selbst geschaffen hatten, mit unseren eigenen Körpern, in direkter Konfrontation mit der bestehenden Ordnung, inmitten des fühlbaren Zusammenbruchs der öffentlichen Gesetze und Normen. Plötzlich hieß es, ein weiterer Stadtrat habe sich unserer Sache angeschlossen, womit die Stadtverwaltung gezwungen sein würde, über den Antrag auf Entschädigungszahlungen abzustimmen.
Wie schon 2012 bei der Ausstellung hatte ich auch hier das Gefühl, dass etwas sehr Wichtiges passiert. Und wie bei der Ausstellung wusste ich, dass so ein Gefühl nur durch eine Art partizipatorisches Theater erzeugt werden kann. Wir mussten eine Krise heraufbeschwören, in uns selbst und in der Öffentlichkeit, um den emergenten und unvollständigen Prozess zur Schaffung demokratischer Bedeutung in Gang zu bringen.
Ich glaube nicht, dass man unter den gegenwärtigen Umständen erwarten kann, dass eine ganze Stadt oder ein ganzes Land derartige Dinge tut. Ich denke nicht, dass wirtschaftliche Probleme uns geradewegs zu sozialer Gerechtigkeit führen werden. Was heute als Demokratie bezeichnet wird, ist eine Falle. Das ist die wahre Krise. Um diese in der Gesellschaft politisch zu thematisieren, müssen wir zunächst lernen, sie ästhetisch zu erschaffen, in uns selbst. Dann müssen wir diese Empfindungsstruktur öffentlich machen. Ein ganz und gar nicht einfacher Prozess.

Francisco Goya’s Fight with Cudgels (1820-23), oil on canvas, 125 x 261 cm. Photo: Museo del Prado. Source: Wikimedia
Schließen möchte ich mit einem weiteren philosophischen Gedanken. In den frühen 1990er-Jahren, nachdem die Sowjetunion gefallen und der westliche Kapitalismus als Sieger gefeiert wurde, eröffnete Michel Serres sein großartiges Buch Le contrat naturel (Der Naturvertrag) mit der Analyse eines Gemäldes von Goya. Es zeigt zwei Kontrahenten, die in einen tödlichen Kampf verstrickt sind – beide versinken gleichzeitig zusammen im Treibsand. “Laßt uns wetten”, schreibt Michel Serres. “Setzt ihr auf Impair; wir haben bereits auf Pair gesetzt. Der Ausgang des Kampfes ist zweifelhaft, darauf verweist das Doppelwesen des Paares: Es gibt nur zwei Kämpfende, die der Sieg ohne jeden Zweifel voneinander scheiden wird. Doch in dritter Position, abseits ihrer Fehde, machen wir einen dritten Ort aus, den Morast, wo der Kampf im Schlamm versinkt.”9
Die Bedeutung von Serres’ Bild sollte klar sein. Und doch glaube ich, sie ist es nicht. Da die Ölkriege im Nahen Osten weitergehen, übertönen der Lärm und die Wut dieser Kämpfe inmitten des rassistischen Gezeters in Europa und Amerika die weit wichtigere Debatte über das Verbrennen von Öl an sich und den zunehmend kritischer werdenden Klimawandel. Während wir über die Begrifflichkeiten der Kapitalismuskrise diskutieren, ist unsere gemeinsame Welt bereits dabei, unter dem Meeresspiegel zu versinken. Krieg ist heute die Norm, Rassismus ist Gesetz, und Vergessen ist das größte existenzielle Territorium, das die Menschen teilen. Wir leben in blockierten Demokratien. Eine Ästhetik der Krise kann nur auf dieser Grundlage entstehen.
Siehe threecrises.org.
Vgl. Raymond Williams, Marxism and Literature. Oxford 1977, S. 132.
Siehe James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State. New York 1973.
Vgl. James O'Connor, The Meaning of Crisis. Oxford 1987, S. 176.
Cornelius Castoriadis, Macht, Politik, Autonomie, in: ders., Ausgewählte Schriften. Band 1: Autonomie oder Barbarei. Übers. von Michael Halfbrodt. Lich 2006, S. 137.
Ebd.
Vgl. Luz, "All eyes are on us, we've become a symbol", in: Les Inrockuptibles (10. Januar 2015); www.lesinrocks.com/2015/01/10/actualite/luz-eyes-us-weve-become-symbol-11545347.
Siehe die Dokumentation Opening the Black Box: The Charge is Torture; chicagotorture.org/#event-opening-black-box-reception.
Michel Serres, Der Naturvertrag. Übers. aus dem Französischen von Hans-Horst Henschen. Frankfurt am Main 1994, S. 11.
Published 17 June 2015
Original in English
Translated by
Gaby Gehlen
First published by Springerin 2/2015 (German version); Eurozine (English version)
Contributed by Springerin © Brian Holmes / Springerin / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.