Beginnen, aufhören, neu anfangen
Über die Zeitschrift Mawaqif und einige Stationen des arabischen Intellektuellen seit 1968
1978, in ihrer ersten Ausgabe nach vierjähriger Unterbrechung, veröffentlicht die libanesische Kulturzeitschrift Mawaqif eine Übersetzung von Meditations on Beginnings, einem Essay von Edward Said aus dem Jahr 1975. Said spricht hierin über das Problem des Anfangs in der Literatur, den Unterschied zum ‚Ursprung’ und den daraus erwachsenden Konsequenzen für die Tätigkeit des Kritikers. Der Essay führt nicht nur einige Ideen des französischen Poststrukturalismus in die arabische Debatte ein. Gleichzeitig richtet er den Blick auf den Neuanfang einer, eben dieser, Zeitschrift. Eine Zeitschrift nun hat viele Anfänge: Ihr existenzieller Anfang, verkörpert in der Pilotausgabe, oder ihr Neubeginn nach einer Phase der Unterbrechung. Der Anfang einer Einzelausgabe oder der Anfang jedes einzelnen der in ihr publizierten Beiträge. So vielstimmig wie die Einzelausgabe einer Zeitschrift spricht, so ist die Gesamtheit der arabischen Kulturzeitschriften im 20. Jahrhundert eine Polyphonie politischer Stimmen und ästhetischer Urteile. Daher ist die Geschichte einer Zeitschrift immer auch die Geschichte mehrerer Zeitschriften: Derjenigen, von denen sie sich abgrenzt, gegen die sie sich verteidigt, oder mit denen sie sich in einer Wahlverwandtschaft sieht, innerhalb ihres eigenen Sprachraums und außerhalb. Man kann sie von vielen Enden oder Anfängen her erzählen. Fangen wir deshalb an irgendeiner Stelle an.
Das Einatmen des Redakteurs
Januar 1973 in Beirut. Das noch junge Jahr wird ein weiteres der politisch ereignisreichen Jahre werden, von denen der arabische Nahe Osten seit den Sechzigern einige erlebt hat: Es ist das Jahr des Yom-Kippur-Krieges, im arabischen Diskurs bekannt als Harb Tishrin (Oktoberkrieg), in dem die arabischen Alliierten einen vermeintlichen Sieg gegen Israel verzeichnen und zum für lange Jahre letzten Mal vom kollektiven Gefühl einer arabischen Einheit ergriffen werden. Es ist das Jahr des Ölembargos, das den Aufstieg der Golfstaaten als Regionalmacht aber auch der wachsenden Abhängigkeit vom Westen markiert. Die autokratischen Militärregimes in Syrien, Irak und Jemen haben sich konsolidiert, die Sache Palästina verliert mit der wachsenden Macht der PLO an uneingeschränkter Solidarität. Die Studentenproteste in Beirut halten an. Das Fernsehen hat endgültig die Position des Leitmediums erobert. Noch zwei Jahre bis zum Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs. Zu Beginn dieses also bald sehr bewegten Jahres hält Suhail Idris, Beiruter Herausgeber und Publizist, die aktuelle Ausgabe seiner Literaturzeitschrift al-Adab (dt.: Literaturen) (1953-) in den Händen. Ihre materielle Präsenz verleitet ihn zu einer kleinen Meditation, zärtlich und andächtig wie ein arabisches Liebesgedicht, die er in der Folgeausgabe veröffentlicht:
Das hier ist die erste Ausgabe des 22. Jahrgangs, die ich vor mir sehe und die mich vor sich sieht. Ich nehme sie in meine Hand, so wie ich auch die 240 Ausgaben vor ihr in die Hand genommen habe. Ich wende sie kurz hin und her, ich blättere für einige Augenblicke darin und reiße dann die Seiten auf. Dann berühre ich das Papier mit meinen Fingern, lese die Überschriften der Artikel, die ich bereits gelesen habe, und rieche an der Tinte. Habe ich schließlich alle Blätter durchgesehen, lege ich sie auf den Tisch und atme glücklich ein.
Idris Einatmen ist ein Aufatmen: Das leidgeprüfte Aufatmen eines Verlegers, der mit den alltäglichen Mühen der Zeitschriftenpublikation vertraut ist, und dem es trotzdem einmal mehr gelungen ist, eine Ausgabe aus der Druckerei zu holen. Einige dieser Mühen verbinden ihn mit Zeitschriftenmachern auf der ganzen Welt: Säumige Autoren, mangelhafte Manuskripte, finanzielle Engpässe und ein kleines Lesepublikum. Gleichzeitig hatte seine Zunft im Libanon und anderen arabischen Staaten mit spezifischen politischen, ökonomischen und institutionellen Produktionsbedingungen zu kämpfen, die eine Kulturzeitschrift zu einem permanent prekären Unterfangen machten: Devisenbeschränkung und Exportbegrenzung, sowie eine teils starke Zensur in Libanons Nachbarstaaten wie Ägypten, Syrien und Irak, die gleichzeitig das Gros der Leserschaft dieser Zeitschriften stellten, brachten die Mehrheit dieser Publikationsprojekte, kaum gegründet, an ein frühes Ende.
Dann aber ist Idris Einatmen auch einfach ein zufriedenes Einatmen. Einmal mehr das Richtige getan zu haben, das heißt, seiner Pflicht als Intellektueller nachgekommen zu sein. An der arabischen Definition dieser Rolle hatte al-Adab keinen unbedeutenden Anteil gehabt: Im Zuge der Kritik am Algerienkrieg in den späten 1950ern und während seines Studiums in Paris war Idris auf Sartre und das Konzept der littérature engagée aufmerksam geworden. Idris war begeistert: Es schien die Antwort auf die Frage zu sein, wie die Literatur zum Teil eines nationalistischen arabischen Projekts werden könne. So nahm Sartres große Popularität in der arabischen Welt vor allem auf den Seiten von Idris al-Adab ihren Ausgangspunkt, einer Zeitschrift, die sich wesentlich am Selbstverständnis ihres Vorbilds Les Temps Modernes orientierte. Hatte Sartre die Schriftsteller darauf verpflichtet, „für ihre Zeit zu schreiben“, so richtete sich auch Idris mit al-Adab an all jene Schriftsteller der arabischen Welt, die „die Erfahrungen ihrer Zeit leben und Zeugnis ablegen“. Hier wie dort galt es, die Literatur an die gesellschaftlichen Belange rückzubinden. Umso schmerzhafter fiel im Jahre 1967 die Trennung und die Abkehr der arabischen Intellektuellen von Sartre aus, nach dessen Nahostreise, der umstrittenen Sonderausgabe der Temps Modernes zum israelisch-arabischen Konflikt und Sartres Solidarisierung mit Israel im Sechs-Tage-Krieg.
Für Zeitschriften zu schreiben, das war in der zweiten Hälfte des arabischen 20. Jahrhunderts ein Muss für all diejenigen, die sich als Schriftsteller verstanden, „engagiert“ oder nicht. Das hatte erst einmal pragmatische Gründe: Die arabischen Literatur- und Kulturzeitschriften übernahmen – wie in vielen anderen Ländern und ihren literarischen Feldern – die Funktion einer Plattform für junge Literaten, die hierdurch erstmals die Möglichkeit erhielten, ihre Gedichte, Romanfragmente und Theaterstücke einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Seit ihren frühen Vertretern im 19. Jahrhundert waren literarische Texte ein zentraler Bestandteil der arabischen Zeitschriften, die ihr Mandat maßgeblich in der Bildung der arabischen Leserschaft sahen. Dem entsprach auch das Selbstverständnis der frühen Zeitschriftenmacher: Man sah sich in der Tradition des adib, des arabischen Gelehrten. Bereits während der Mandats- bzw. Kolonialzeit, verstärkt aber im Zuge der Nationalstaatenbildung, erfuhr die arabische Kulturzeitschrift im frühen 20. Jahrhundert dann eine starke Politisierung: Sie wurde Artikulationsplattform, Vernetzungs- und Propagandaorgan unterschiedlicher nationalistischer Strömungen und so zu einem zentralen Medium gesellschaftlicher und kultureller Dekolonisierung. Die Literatur und mit ihr der Literat, politisierte sich im selben Zuge. Es entstand auf den Seiten dieser Zeitschriften eine Figur, die auch in der arabischen Welt des vergangenen Jahrhunderts mehrfach sterben und wieder auferstehen sollte: der Intellektuelle (al-muthaqqaf). Für Zeitschriften zu schreiben, das war für ihn nicht einfach Pflicht, sie selbst zu gründen keine edle Kür, sondern gehörte zu den konstitutiven Momenten seines Selbstverständnisses.
Zu den ungeschriebenen Gesetzen des Intellektuellen und seines publizistischen Genres, der Kulturzeitschrift, zählt, dass sie ihre großen Momente in der Krise haben. In der Krise definiert und legitimiert sich der Intellektuelle neu, oft genug durch die Gründung einer Zeitschrift. Auch die Zeitschrift, um die es hier gehen soll, ist ein solcher Fall: Die Krise, auf der sie sich be/gründet, teilt bis heute die arabische Ideengeschichte in ein diskursives Davor und Danach. Und die Zeitschrift wird im Verlauf ihres Erscheinens zwischen 1968 und 1994 noch auf zahlreiche ideologische, materielle und institutionelle Krisenmomente reagieren – und auf diese Weise einen der umbruchreichsten Abschnitte der modernen arabischen Ideengeschichte dokumentieren und mitprägen.
Beirut, Stadt der Anfänge
Oktober 1968. Eine neue Zeitschrift liegt in den Auslagen und Zeitungsständern der einschlägigen Beiruter Buchhandlungen und wird auf den Campus der Universitäten Studierenden in die Hand gegeben. Ihr Cover verrät nichts außer ihrem Titel, der schnörkellos über eine geometrische, schlichte Grafik gesetzt ist: Mawaqif (dt.: Stationen; Positionen).

Mawaqif 1 (1968)
Wir befinden uns in den „langen sechziger Jahren“, jener aus heutiger Sicht fast schon mythologischen Periode, die im Westen und den postkolonialen Staaten das Aufkommen neuer revolutionärer Bewegungen bezeugte. Es ist zudem Beiruts späte Phase einer „arabischen Gelehrtenrepublik“, wie der Journalist Samir Kassir sie einmal nannte, in der die aus allen arabischen Ländern zugewanderten hommes und femmes des lettres eine nahezu uneingeschränkte politische und künstlerische Freiheit genießen: Dank Libanons schwachem Staat, seiner ebenso schwachen Zensur und seiner langen publizistischen Tradition hatten sich an keinem anderen Ort der arabischen Welt seit den 1940ern mehr Verlage und Druckereien, aber auch mehr Zeitschriften angesiedelt.
Diese neue Zeitschrift also. Erst das Impressum gibt mehr über sie preis: Anstatt der sonst für die arabische Zeitschrift üblichen Genrezuweisung („literarisch“, „politisch“ oder allgemein „kulturell“) prangt ein Schlachtruf: „Für Freiheit, Innovation und Veränderung!“ Als Urheber gibt sich der syrische Dichter Adonis (*1930) zu erkennen, der seinen bürgerlichen Namen Ali Ahmad Said Esber nur noch in offiziellen Dokumenten führt. Im Vorwort der ersten Ausgabe und im für Zeit und Genre typischen Duktus des Manifests verkündet Adonis die Zielsetzung der Zeitschrift:
Mawaqif (…) ist ein ständiger Akt der Konfrontation. Sie überwindet jedwede Unterdrückung und Autorität, mit der Absicht, die arabische Geschichte und Kultur zu hinterfragen und das arabische Denken von Grund auf zu erneuern. (…) Mawaqif ist die Kultur – die Revolution.
Der kundige zeitgenössische Leser konnte anhand dieser wenigen furiosen Worte erste Schlüsse über die neue Zeitschrift ziehen. Adonis wird ihm bereits bekannt gewesen sein:1 Zum einen, weil jener gerade auf dem Weg war, einer der größten Dichter moderner arabischer Lyrik zu werden – und die Lyrik war die literarische Leitdisziplin der arabischen Kultur, die ein Massenpublikum zu begeistern imstande war. Zum anderen, weil Adonis in den Jahren zuvor bereits mit einer anderen Zeitschrift assoziiert wurde, deren Chefherausgeber er gewesen war und mit der er 1964 gebrochen hatte: Die Gruppe um die Literaturzeitschrift Shi’r (dt.: Dichtung) (1958-70), die sich noch radikaler als frühere Vertreter des arabischen Modernismus von der traditionellen Formsprache arabischer Dichtung, allen voran ihrem Versschema, abgesetzt hatte. Die Befreiung der Lyrik, so die Auffassung der Gruppe um Adonis und den Zeitschriftengründer Yussuf al-Khal, sei der erste Schritt, um das arabische Subjekt von seinen verkrusteten Traditionen und Denkmustern zu befreien und ihm den Eintritt in eine globale Moderne zu ermöglichen.
Shi’rs Faible für europäische Modernisten, ihre vermeintliche Zerstörwut der arabischen poetischen Tradition und ihr Credo einer künstlerischen Autonomie – all das glich im arabischen literarischen Feld, in dem eine nationalistische, engagierte Literatur den Ton angab, der Häresie. Zeit ihres Bestehens war die Zeitschrift daher starker Kritik von linker Seite ausgesetzt. Obwohl und gerade weil sich Adonis in der Verteidigung von Shi’r stark exponierte, wurde ihm nach seinem Bruch diese zentrale Rolle, die er innerhalb der Zeitschrift innegehabt hatte, zum Hindernis. Um seinen Namen von dem Shi’rs zu lösen, half ihm einerseits eine politische Neujustierung: Adonis näherte sich nach 1964 marxistischen Positionen an und wurde regelmäßiger Beitragender in Shi’rs größtem Antagonisten, al-Adab. Besser aber noch bedurfte es eines eigenständigen Projekts, das weit genug von Shi’r entfernt sein musste, um nicht als Nachahmung zu gelten, jedoch nah genug, um die modernistische Mission, mit der sowohl Shi’r als auch die Persona Adonis identifiziert wurden, fortzuführen. Mawaqif wagte sich auf diesen schmalen Grat: Von ihrer ersten Ausgabe an wird sie vor allem jungen und noch weitgehend unbekannten Dichtern einen zentralen Platz einräumen. Anders aber als Shi’r macht Mawaqif nicht die Dichtung allein, sondern sämtliche Bereiche der arabischen Gesellschaft zum Gegenstand ihres kritischen Projekts. Wie das erste Vorwort festhält, sind Gedichte und Essays – mit anderen Worten: literarische und theoretische Produktion – nicht länger zwei getrennte Sphären, sondern sie werden zu „einer Praxis des Schreibens“, die demselben Ziel dient: Wandel hervorzurufen.
Mawaqifs gelungene Gründung verdankt sich aber mehr als nur einer geschickten Abgrenzung von Adonis früherem Zeitschriftenprojekt. Seine ‚eigene’ Zeitschrift erscheint im Kontext eines politischen Ereignisses, das grundlegend jener Selbstwahrnehmung arabischer Überlegenheit widersprach, die seit Nasser das politische Bewusstsein beflügelt hatte: Am 5. Juni 1967 unterliegen im Sechs-Tage-Krieg die arabischen Militärs der israelischen Armee in einem Überraschungsangriff, infolgedessen eine weitere Viertelmillion Palästinenser in die Nachbarstaaten flüchten. Die naksa (dt.: Rückschlag) trifft vor allem auch all diejenigen hart, die sich als geistige Vordenker begriffen und diese Niederlage nicht hatten kommen sehen, oder sehen wollen. „Es traf uns wie ein Blitz,“ erinnert sich Sadiq Jalal al-Azm (1934-2016). Der syrische Philosoph, Marxist und zwischen 1972 und 1980 Mitherausgeber von Mawaqif hat wie viele seiner Zeitgenossen den Juni-Krieg als politisches und intellektuelles Erweckungserlebnis beschrieben. Er selbst gehört zu den ersten Stimmen, die fordern, das militärische Debakel als Anlass zu nehmen, den Blick endlich auf die selbstverursachten Missstände der arabischen Länder zu richten.2 Adonis wiederum veröffentlicht in der unmittelbaren Folge des Juni-Kriegs das „Manifest des 5. Juni 1967“, das im Frühjahr 1968 sowohl in al-Adab, der marokkanischen Zeitschrift Souffles und in Übersetzung in der französischen Zeitschrift Esprit abgedruckt wird. Hierin fordert der Dichter den arabischen Intellektuellen auf, Verantwortung zu übernehmen gegenüber der allgemeinen Unterentwicklung der arabischen Gesellschaften. In Zolascher Manier heißt es: „Ich klage dieses Gespenst, das ich zeitgenössisches arabisches Denken nenne – und ich bin selbst Teil dessen – seiner Unfähigkeit und seines Unvermögens an. (…) Ich klage es der Gefolgschaft und des Plagiats an.“
Mawaqifs Pilot im Herbst 1968 inszeniert sich folgerichtig wie eine Antwort auf diese Forderung nach einem neuen Intellektuellen und als Materialisierung einer arabischen Selbstkritik. Sie bringt Beiträge arrivierter arabischer Autoren, wie den ägyptischen Philosophen Zaki Naguib Mahmoud (1905-1993) oder die ägyptische literarische Instanz Naguib Mahfouz (1911-2006), die die Konsequenzen der naksa auf das intellektuelle und literarische Schaffen diskutieren. Sie lässt vor allem aber auch jüngere Autoren zu Wort kommen, etwa den Soziologen und späteren Mitherausgeber Halim Barakat (*1936) mit einer kritischen Studie zum Konfessionalismus in der libanesischen Gesellschaft. Und sie veröffentlicht – hier ganz Erbin Shi’rs – junge arabische Dichtung und räumt Übersetzungen von Lyrik und bald auch Theorie einen zentralen Platz ein. Die Theorie, an der Mawaqif bis zu ihrer ersten Unterbrechung 1974 interessiert sein wird, sind vor allem Texte der Neuen Linken: Jean-Paul Sartre, Henri Lefebvre, Herbert Marcuse, Louis Althusser. Der deutliche Frankreich-Bezug liegt unter anderem darin begründet, dass Adonis in den frühen Sechzigern während eines längeren Aufenthalts enge Bande zu Protagonisten des französischen intellektuellen Felds geknüpft hatte. Zum anderen darin, dass die ehemalige Mandatsmacht Frankreich nach wie vor großen kulturellen Einfluss auf die libanesischen und syrischen Bildungsschichten ausübt.
Diese Verbundenheit zeigt sich nicht zuletzt auch an einer sozialen Bewegung, mit der sich Mawaqif bereits in der Pilotausgabe klar solidarisiert: Es ist das Jahr 1968, in Europa und den USA haben die Studentenproteste und Bürgerrechtsbewegungen der sixties ihren Höhepunkt erreicht. Das globale Phänomen einer linken Politisierung der Studentenschaft lässt auch die Studierenden in der arabischen Welt nicht unberührt. Vor allem in Kairo und Beirut formiert sich in den Sechzigern eine studentische Protestbewegung, die 1968, gleichermaßen befeuert durch die Niederlage im Juni-Krieg als auch die zeitgleich stattfindenden Proteste an westlichen Universitäten, ebenfalls in ihre intensivste Phase eintritt. Wie in Paris oder Berlin werden in Beirut nicht nur Forderungen nach einer Reform des Universitätssystems laut, sondern nach einer Veränderung des politischen Systems überhaupt. Im Vorwort zu einem Sonderteil über die „Lage des universitären Systems im Libanon“ bekräftigen die Herausgeber von Mawaqif, dass man „die Frage der Universitäten nicht als eine der Reform, sondern als eine der Revolution (sehe), im Geiste von Wissenschaft und Fortschritt und in Hinwendung zur Zukunft.“

Mawaqif 12 (1971)
Die Frage nach der arabischen Zukunft, das ist nach 1967 immer auch und vor allem die Frage nach Palästina. Die Widerstandsbewegung spielt innerhalb der sich militarisierenden Studentengruppen und der libanesischen Linken eine formative Rolle: Die Verbindung von revolutionärer Theorie und Praxis ist kein reines Lippenbekenntnis mehr. Für das linke Spektrum der Beiruter Zeitschriftenlandschaft, wozu Mawaqif lange Jahre gezählt werden darf, wird die Solidarisierung mit al-qadiya al-filastiniyya (der palästinensischen Sache) identitätsstiftend. Einerseits betrifft dies etablierte Beiruter Zeitschriften wie die kommunistische Politzeitschrift al-Tariq, andererseits befeuert die Einbettung palästinensischer Organisationen ab 1969 neue Publikationsprojekte, wie die von der PLO herausgegebene Shu’un Filastiniyya. Während sich diese Zeitschriften jedoch vor allem mit politischen und sozialen Fragen auseinandersetzen, widmet sich Mawaqif den kulturellen Fragen, die das palästinensische Problem aufwirft, und besetzt hiermit eine publizistische Leerstelle.
Bis zum Ende der siebziger Jahre wird hier die Diskussion um den revolutionären Schriftsteller und die Widerstandsdichtung geführt. 1970 erscheint die erste Schwerpunktausgabe zu Palästina mit prominenten Vertretern des Widerstands, unter anderem mit Beiträgen von Ghassan Kanafani, dem begnadeten Schriftsteller und Sprecher der PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) und Naji Allush, dem Generalsekretär der Palästinensischen Schriftstellerunion und führenden Mitglied der Fatah. Bis in die frühen 1980er Jahre wird Mawaqif einen sehr spezifischen ideologischen Standort vertreten, der sich deutlich sowohl von der früheren liberalen Position Shi’rs als auch von der klassischen kommunistischen Linken abgrenzt.
Dieser Standort verdankt sich vor allem einer einzigartigen Komposition der Herausgeberschaft: Sind es zu Beginn vor allem Adonis und die Literaturwissenschaftlerin Khalida Said, seine Ehefrau, so treten schon bald einige Akteure der redaktionellen Kerngruppe bei, die die Zeitschrift in den Folgejahren maßgeblich prägen werden: Neben Halim Barakat und Sadiq al-Azm gehören hierzu vor allem der palästinensische Historiker Hisham Sharabi (1927-2005), der irakische Dichter Buland al-Haidari (1926-1996), der palästinensische Künstler Kamal Boullata (*1942), der libanesische Künstler Samir Sayigh (*1945), etwas später der syrische Literaturwissenschaftler Kamal Abu Deeb (*1942) und der libanesische Journalist, Kritiker und Schriftsteller Elias Khoury (*1948). Trotz kleiner Auflage, keinerlei externen Finanzierung und einem Verbot in der Mehrzahl der arabischen Staaten etabliert sich Mawaqif bereits in ihrer Frühphase als eines der produktivsten und prominentesten Organe intellektueller Kritik und literarischen Experiments in der arabischen Zeitschriftenlandschaft. 31 der insgesamt 74 Ausgaben veröffentlichte sie in den ersten acht Jahren ihres insgesamt 25-jährigen Bestehens – bis zum ersten ihrer drei Enden.
Beirut, Stadt der Enden
Im Frühjahr 1975 entladen sich die in den Vorjahren aufgebauten innenpolitischen Spannungen: Der libanesische Bürgerkrieg tritt in seine erste gewaltreiche Phase ein, die bis 1978 anhalten wird. Die Konstellation der gegeneinander kämpfenden Milizen, die mehrheitlich entlang konfessioneller Grenzen verläuft, führt zur Teilung Beiruts in einen muslimisch dominierten Westen und einen christlich dominierten Osten der Stadt. Das Übertreten der Green Line, die beide Stadtteile trennt, bezahlt man in der Regel mit dem Leben. Mawaqifs Redakteure, die in beiden Teilen Beiruts leben, müssen ihre wöchentlichen Redaktionstreffen einstellen und damit die Publikation ihrer Zeitschrift.
Es wird bis Januar 1978 dauern, ehe die Redaktion ihre Arbeit wieder aufnehmen und die Nummer 32 veröffentlichen kann. Anstatt avantgardistischer Aufbruchsrhetorik ringt in ihr ein Dilemma: Die Ohnmacht intellektueller Tätigkeit angesichts einer rohen und entgrenzten Gewalt; und das moralische Mandat, diese Tätigkeit doch weiter verfolgen zu müssen. „Dieser Krieg“, so Elias Khoury im Editorial der neuen ersten Ausgabe „wird nicht aufhören.“ Was tun also? Neu beginnen: „Der Krieg ist Signifikant eines Anfangs.“ Eines Anfangs aber, dem es fortan um das Anfangen selbst geht, der keine ‚Wahrheit’ mehr folgen lässt. Das Selbstverständnis der Zeitschriftenmacher hat sich merklich verschoben: „Wir missionieren für nichts, und wir verkünden nichts. Wir notieren Beobachtungen und Fragen. Aber wir fühlen, spüren und berühren die Geburt einer anderen Zeit, die einer anderen Sprache und zahlreicher Tode bedarf.“3
Die revolutionäre Aufbruchsstimmung, die nach 1967/68 eine ganze Generation in Bewegung gebracht hatte, ist zu großen Teilen erstickt. Die Beteiligung der libanesischen Linken an den Kriegshandlungen, insbesondere am Massaker von Damour, ließ bei vielen linken Intellektuellen fundamentale Zweifel an der eigenen ideologischen Unfehlbarkeit aufkommen.4 Gewalt antwortete auf Gewalt, der viele von ihnen selbst, teils durch gezielte Attentate, zum Opfer fielen. Nach 1967 war es Mawaqifs Herausgebergruppe, im Einklang mit der Neuen Linken, um ein neues Verständnis der Revolution gegangen, die globaler gedacht werden sollte und sich im palästinensischen Widerstandskampf kristallisierte. Der Bürgerkrieg aber befleckte auch diese Utopie: Auch dem, der nur den Stift und nicht auch das Schwert hielt, klebte fortan Blut an den Händen. Wie war es unter diesen Umständen um das Wirken desjenigen bestellt, dessen Beruf die Kritik war – wie Rainer Lepsius den Intellektuellen definiert hatte? War literarisches und kritisches Schreiben in dieser Wirklichkeit überhaupt noch möglich? Nur, so schien es, wenn das Schreiben selbst, radikaler und unbarmherziger als zuvor, zum Gegenstand der Kritik wurde.
Auch das kündigt Khourys Editorial an: Mawaqif wird in den folgenden Jahren Spiegel und Plattform einer Diskursverschiebung innerhalb eines Teils dieser arabischen Linken, die sich vom Neomarxismus ab und dem Poststrukturalismus zuwendet. Schlüsseltexte von Ferdinand de Saussure, Roland Barthes und Jacques Derrida werden hier erstmals ins Arabische übersetzt. Es werden aber auch arabische Literaturkritiker und Historiker dem arabischen Publikum vorgestellt, deren Werk maßgeblich vom poststrukturalistischen Denken inspiriert ist: Etwa Edward Said (1935-2003) (1978-79 selbst Mitherausgeber), dessen Orientalismus die arabische Leserschaft spaltet, oder Muhammad Arkoun (1928-2010), dessen Lektüre des Islam als Diskursgeschichte heftige Kritik von religiösen Gelehrten nach sich zieht. Dekonstruktion und Diskursmacht werden zu wichtigen Konzepten. Immer noch geht es Mawaqif um die Befreiung der arabischen Sprache und Gesellschaft, jedoch hat sich das politische Klima, das die Mittel dieser Befreiung bestimmte, geändert. Die arabische Linke ist geschwächt, und in den 1980ern tritt eine neue Kraft auf die Bühne: Der politische Islam, der in den Jahrzehnten zuvor eher an den Randbereichen säkularer Debatten zu finden war, wird nun zu einem ernstzunehmenden Thema. Den Debatten in Europa in derselben Zeit nicht unähnlich nimmt im selben Zuge die Frage nach der „Kultur“ (der eigenen, der fremden, vor allem aber der islamischen) eine Zentralstellung in der arabischen Debatte ein, die vor allem auch in Mawaqif ab den 1980ern geführt wird.

Mawaqif 34 (1979)
Ausgabe 34 vom Frühjahr 1979 scheint hierfür ein Schwellenmoment. Der Sturz der iranischen Monarchie unter Reza Schah Pahlavi durch die vom schiitischen Geistlichen Ajatollah Khomeini und seinen Anhängern angeführte Revolution hatte im Westen wie in der arabischen Welt gemischte Reaktionen im linken Lager hervorgerufen. Man erinnert sich heute vor allem an Foucaults Fehleinschätzung, der in dem Ereignis keinen politischen Regimewechsel zu einer Theokratie sehen wollte, sondern einen Widerstand gegen die Herrschaftsform der Moderne schlechthin. Auch die arabischen Intellektuellen teilt das Ereignis in zwei Lager: Während die einen die Revolution als Sieg des unterdrückten Ostens gegen den imperialistischen Westen, den der Schah in den Augen vieler repräsentierte, feiern, sehen es die anderen als Sieg der Religion über den Klassenkampf. Mawaqifs Herausgebergruppe, selbst Teil der ersten Fraktion, widmet dem Thema in dieser Ausgabe einen langen Sonderteil. Neben ihrer grundlegend positiven Haltung gegenüber der Revolution Khomeinis verbindet die Beiträge auch eine Kritik am orthodoxen Marxismus: Entgegen dessen Lehrmeinung, die Religion sei das „Opium des Volkes“, heben alle Autoren auf die ein oder andere Weise deren mobilisierendes Potenzial hervor, das sich in der Revolution gezeigt habe.
Allerdings unterscheiden sich ihre Bewertungen zur Rolle dem Islams in der Revolution. Elias Khoury etwa sieht in der Revolution die historische Kontinuität eines politischen Kampfes, der den Ajatollah mit dem Reformer des späten 19. Jahrhunderts Jamal al-Din al-Afghani verbinde. Dessen Ziel war eine Modernisierung des Islam, den Afghani als das Bindeglied zwischen den Völkern des Orients und damit als einzige Waffe gegen den westlichen Imperialismus auffasste – und gegen den sich, so Khoury, nun auch die iranische Revolution richte. Chefredakteur Adonis geht in seinem Beitrag, in gewisser Weise Foucault nicht unähnlich, über die Politik hinaus: Für den Dichter wird im Moment des Umsturzes die authentische Kultur des Ostens sichtbar, die für zu lange Zeit von einer westlichen Scheinkultur verdeckt worden sei. Islam, das ist hier weder eine religiöse Lehre noch eine politische Praxis, sondern das Wesen der östlichen Kultur selbst, weshalb auf dessen Grundlage allein ein wahrhafter sozialer Wandel entstehen könne.
Die Begeisterung über die iranische Revolution, die diese Ausgabe prägt, führt allerdings zu heftigen Reaktionen. Einer der exponiertesten Kritiker ist der Mitherausgeber Sadiq al-Azm, der Mawaqif in Folge dieser Ausgabe offiziell verlassen wird. Seine harsche Kritik an der Position der ehemaligen Kollegen, allen voran an Adonis’ kulturalistischer Interpretation der Revolution, formuliert er 1981 in seiner Rezension von Orientalism. Edward Saids Studie war kurz zuvor in Übersetzung von Kamal Abu Deeb, selbst leitender Redakteur von Mawaqif, auf Arabisch erschienen und auszugsweise in der Zeitschrift vorveröffentlicht worden war. Al-Azm sieht sowohl in Saids Studie selbst als auch in Adonis Reaktion einen „umgekehrten Orientalismus“ am Werk, der eben jenen Essentialismus reproduziere, den er selbst behaupte zu kritisieren.
Die sich in den Folgejahren über Mawaqif und weitere Periodika erstreckende Kontroverse zwischen den ehemaligen Weggefährten al-Azm und Adonis wird über beider Lebenszeit andauern.5 Sie wird außerdem zum paradigmatischen Beispiel für die Spaltung säkularer Intellektueller angesichts des politischen Islam. Zwar wird sich Adonis – wie auch alle anderen Beitragenden der Nummer 34 – wenige Jahre nachdem sich das neue Regime in Teheran konstituiert und seinen repressiven Charakter offenbart hatte, von der euphorischen Anfangsreaktion distanzieren. Die Vorstellung eines wesenhaften Unterschieds von West und Ost, und mit ihm die Frage eines innovativen Rückgriffs auf das kulturelle Erbe dieses Ostens und des Islam, wird den Chefredakteur von Mawaqif jedoch weiter beschäftigen und seine Herausgeberschaft bis zum Ende prägen.
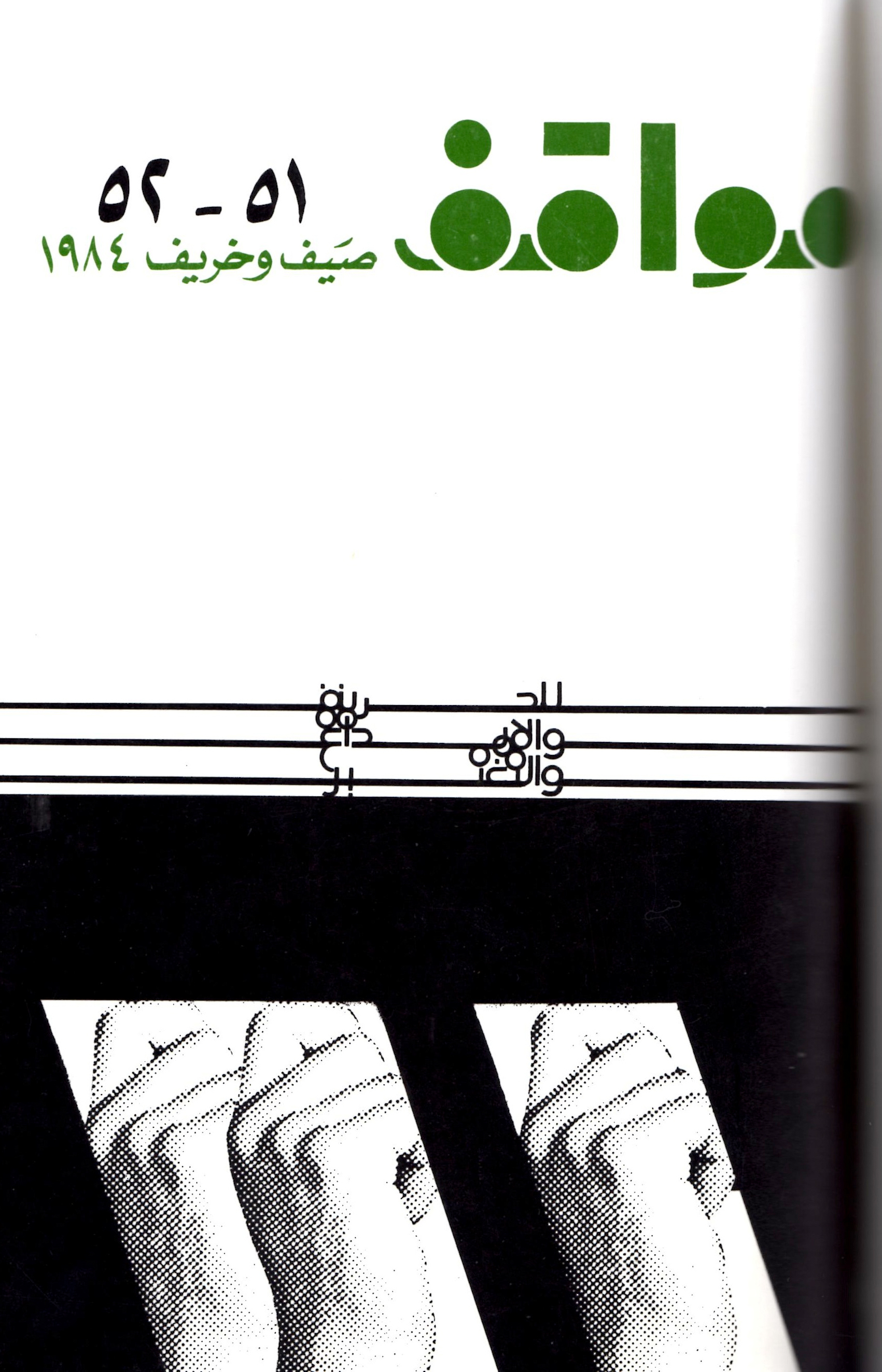
Mawaqif 51/52 (1983)
Nachdem der Bürgerkrieg 1982 mit der Invasion Israels einen neuen Höhepunkt erreicht, verlassen Adonis und Khalida Said Beirut im Jahr 1984 und emigrieren nach Paris. Die Bemühungen, Mawaqif zwischen diesen beiden Städten weiter zu publizieren, scheitern am Ende auch an persönlichen Differenzen der Herausgebergruppe. Die Publikation der Zeitschrift wird ein weiteres Mal eingestellt. 1988 erscheint sie zum dritten Mal, erstmals finanziert und veröffentlicht von einem großen arabischen Verleger, dem in London ansässigen Saqi House.
Ihr Erscheinen wird sich mit dem Wechsel von einem eigenfinanzierten Kollektivprojekt zur profitorientierten Verlagsstrategie stark wandeln. Verglichen mit ihren frühen Jahren, in denen beinahe jede Ausgabe einer neuen Struktur folgte und so zurecht den Eindruck vermittelte, die Zeitschrift sei eine lebendige Reaktion auf ihre Zeit, „verdichtet“ sie sich ab 1988 zusehends: Layout und Rubriken sind nun stabil, mitunter nimmt sie beinah monografische Züge an und erscheint immer häufiger unter einem großen Schwerpunktthema. Beiträge stammen nun stärker als zuvor aus europäischer Feder, auch wenn die Zeitschrift nach wie vor die großen arabischen Namen aus Literatur und Kritik auf ihren Seiten versammelt. Mawaqif wirkt satt, wenn nicht saturiert. Aber sie hält ihr erarbeitetes Renommee, von Bagdad bis Rabat, als eine der führenden Kulturzeitschriften der arabischen Welt.
Im Januar 1973 ist all dies noch Zukunftsmusik. Suhail Idris wird seine Zeitschrift al-Adab selbst durch den Bürgerkrieg bringen, sie wird sie alle überdauern. Am Ende seiner Meditation, zu der die Aura der Zeitschrift ihn animiert hatte, wendet er den Blick von sich selbst ab und dem Leser zu:
Was mich im Laufe der letzten Jahre getröstet und meine Erschöpfung aufgewogen hat, war es mir vorzustellen, wie der Leser jeden Monat auf die neue Aufgabe wartet und in seiner Stammbuchhandlung nach ihr fragt. Sein Herz schlägt, wenn er sie im Schaufenster ausliegen sieht, und er atmet auf. Hatte er doch die Befürchtung gehabt, dass sie nicht mehr erscheinen könnte.
Der Leser von Mawaqif würde im Herbst 1994 vergebens in seiner Stammbuchhandlung in Beirut oder Casablanca, seinem Briefkasten in Paris oder Berlin nach Mawaqif suchen. Kein Aufatmen. Die Zeitschrift wurde nach Ausgabe 74 zur Frage der arabischen Frau eingestellt. Wie die meisten ihrer Art, und in maximalem Kontrast zur aufbrausenden Pilotausgabe, ist ihr Ende ein stilles.

Mawaqif 72 (1993)
Adonis, geboren 1930 in eine alawitische Familie nahe des syrischen Latakia, wird als einer, wenn nicht der bedeutendste Dichter der modernen arabischen Poesie gehandelt. Zu seinen bekanntesten Werken, die in mehrere europäische Sprachen und in verschiedenen Anthologien übersetzt wurden, gehören „Die Gesänge Mihyars des Damaszeners“ und „Ein Grab für New York“. Zu seinen einflussreichsten Arbeiten im Bereich der Kulturkritik und Literaturgeschichte zählen der zwischen 1964 und 1968 erschienene „Diwan al-Shi’r al-Arabi“ (einer Anthologie arabischer Dichtung vom Vorislam bis zur Moderne) und die zwischen 1974 und 1978 publizierte vierbändige Abhandlung „Al-Thabit wa-l-Mutahawwil“ (über die Frage von Tradition und Innovation innerhalb der arabischen Kultur). Seit 1985 lebt Adonis mit seiner Frau Khalida Said in Paris.
Sadiq Jalal al-Azm, Sohn einer einflussreichen sunnitischen Damaszener Familie, zählt zu den bedeutendsten arabischen Intellektuellen seiner Generation. Für seine Abhandlung „Die Kritik des religiösen Denkens“ wurde er unter dem Vorwurf der „Anstiftung zum Konfessionalismus“ von den libanesischen Behörden inhaftiert (1969; engl. Übersetzung „Critique of Religious Thought“, erschienen 2015 bei Gerlach Press). Sein Essay „Selbstkritik nach der Niederlage“ gilt als diskurbegründender Text für einen „selbstkritischen Turn“ in der arabischen Ideengeschichte nach 1967 und hatte ebenfalls erhitzte Debatten ausgelöst (1968; englische Übersetzung „Self-Criticism after the Defeat“, erschienen 2011 bei Saqi Books). Al-Azm, der sein Leben zwischen Beirut, Damaskus, den Vereinigten Staaten und zuletzt Berlin verbracht hat, verstarb dort 2016.
Elias Khoury, der als Herausgeber für verschiedene libanesische Zeitschriften und Zeitungen tätig war, ist innerhalb und außerhalb der arabischen Welt vor allem für sein Romanwerk bekannt geworden. Seine Romane „Die Reise des kleinen Gandhi“ (1989), „Tor zur Sonne“ (1998) und „Yalo“ (2002) wurden in mehrere europäische Sprachen übersetzt. In diesem Jahr erscheint der erste Teil seiner Romantrilogie „Kinder des Ghettos: Mein Name ist Adam“ (2016) in englischer Übersetzung (MacLehose Press). Khoury lebt in seiner Heimatstadt Beirut.
Das Massaker in der maronitischen Kleinstadt Damour wurde am 20. Januar 1976 verübt und forderte mehrere hundert Tote. Trotz widersprüchlicher Angaben über die genaue Zusammensetzung der Tätergruppe waren es maßgeblich der PLO zugehörige Untergruppen unter Beteiligung von Teilen des linken Lebanese National Movement (LNM). Es gilt als Vergeltungsschlag für das von den christlichen Phalangisten verübte Massaker im Beiruter Viertel Karantina zwei Tage zuvor.
Zum letzten Mal brandet die alte Debatte zwischen den beiden syrischen Intellektuellen im Zuge von Adonis’ öffentlichen Reaktionen in der Frühphase des syrischen Bürgerkriegs auf. Sowohl seine als Legitimation interpretierte Ansprache von Bashar al-Assad als „Herr Präsident“ in einem offenen Brief, als auch sein Unmut angesichts der Tatsache, dass die Demonstrationen in Deraa sich aus den (sunnitischen) Moscheen heraus formiert hatten, brachte Adonis den Vorwurf der Bigotterie und des Konfessionalismus ein. Sadiq al-Azm, einer seiner vehementesten Kritiker, vermutete hierin eine Kontinuität in Adonis’ Zugehörigkeitsgefühl zum schiitischen Islam, dem dieser als Alawit offiziell angehört und der sich, so al-Azm, erstmals bereits in seinem Zuspruch zur iranischen Revolution gezeigt habe. Adonis, der immer für Säkularismus und Humanismus gestanden hatte, verspielte mit dieser Affäre einen Großteil seines Kredits in der arabischen Öffentlichkeit.
Published 26 July 2018
Original in German
First published by Eurozine
Contributed by Arbeitskreis Kulturwissenschaftlicher Zeitschriftenforschung © Yvonne Albers / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.


